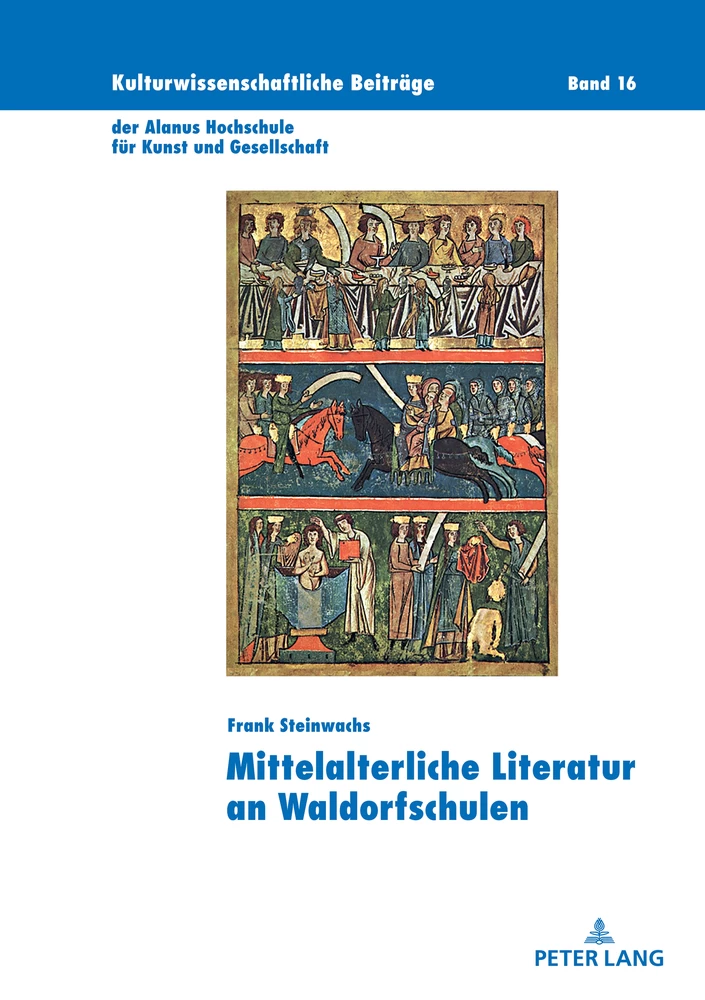Mittelalterliche Literatur an Waldorfschulen
Pädagogische Implikation einer subjektorientierten Didaktik für die mittelalterliche Literatur im Deutschunterricht an Waldorfschulen im Kontext des didaktischen Diskurses am Beispiel von Wolframs „Parzival“ in Klasse 11
Zusammenfassung
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Copyright
- Autorenangaben
- Über das Buch
- Zitierfähigkeit des eBooks
- Danksagung
- Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung, Problemstellung und Zugangsschwierigkeiten
- 1.1 Vorbemerkung
- 1.2 Ideologie, Anderssein und Begegnungsprobleme – Ein belastetes Terrain
- 1.2.1 Zu den Schwierigkeiten im Umgang mit anthropologischen Annahmen
- 1.2.2 Ablehnung und (Neu-)Begegnung – Die Erforschung der Waldorfschule als Kommunikationsproblem
- 1.2.3 Rudolf Steiner als Quelle der Waldorfpädagogik
- 1.2.4 Institution und Selbstverständnis
- 1.2.5 Anthropologie als Grundlage didaktischen Handelns in der Waldorfpädagogik
- 1.3 Das Desiderat und das Ziel der Arbeit
- 1.4 Zugang und Vorgehen
- 2 Zur Situation einer subjektorientierten Literaturdidaktik im Spannungsfeld von Forschung, Kompetenzorientierung und Schulpolitik
- 2.1 Die Pädagogik, die Literaturdidaktik und das Subjekt – Eine begriffliche Annäherung
- 2.1.1 Vorbemerkung
- 2.1.2 Bildung und Kompetenz – Eine Anmerkung zu ihrer Verschränkung
- 2.1.3 Bildung: Erfahrungsbasierte Transformation des Selbst plus Ethik? – Eine kleine Standortbestimmung
- 2.1.4 Bildung und Literaturunterricht – Eine kritische Bestandsaufnahme
- 2.2 Theoretische Zugänge zu einer Subjektorientierung in der Literaturdidaktik
- 2.2.1 Als Ausgangspunkt: Die Wirklichkeit der Literatur und die Subjektorientierung
- 2.2.2 Literatur- und kulturdidaktische Ansätze
- 2.3 Exkurs: Objekt- und Subjektorientierung in der Phasierung von Unterrichtsstunden als hermeneutische und konzeptionelle Vermittlungsstruktur
- 2.3.1 Vorbemerkung
- 2.3.2 Phasierungskonzepte zwischen Objekt- und Subjektorientierung
- 2.4 PISA und die Folgen für Schule, Literaturdidaktik und Subjektorientierung
- 2.4.1 Literaturunterricht im Spannungsfeld von PISA, Politik und Forschung
- 2.4.2 Kompetenzorientierung zwischen Subjekt- und Objektbezug im Literaturunterricht – Ein Widerspruch?
- 2.5 Als Abschluss: Eine kritische Bilanz zum konzeptionell begründeten Subjektbezug in der Schulpraxis
- 3 Die Didaktik der mittelalterlichen Literatur und die Subjektorientierung
- 3.1 Vorbemerkung zum problematischen Verhältnis vom Diskurs der universitären Mittelalterliteraturdidaktik und seiner schulpraktischen Bedeutung
- 3.2 Zur historischen Entwicklung einer Didaktik für die mittelalterliche Literatur zwischen Vereinnahmung, politischer Identitätskonstruktion und moderner Identitätsbildung
- 3.2.1 Vorbemerkung
- 3.2.2 Die neue Bedeutung der mittelalterlichen Literatur in der Schule – Von der Konstruktion einer historischen Identität zur rassistischen Kriegsideologie 1871-1945
- 3.2.3 Erb-Last, Neu-Orientierung und Legitimationsprobleme – Zum Verschwinden der mittelalterlichen Literatur im Unterricht und neue Etablierungsversuche zwischen 1945/49 und den 1990er-Jahren
- 3.2.4 Zuwendung und Neuorientierung – Eine kurze Bilanz der mittelalterlichen Literatur zwischen den 1990er-Jahren und 2005
- 3.3 Objekt- und Subjektorientierung in der aktuellen Mittelalterliteraturdidaktik
- 3.3.1 PISA und die Antwort(en) der Mittelalterliteraturdidaktik – Anmerkung zu einer langen Reaktionszeit
- 3.3.2 Kompetenzorientierung in der Mittelalterliteraturdidaktik ab 2005
- 3.3.2.1 Vorbemerkung zur Kompetenzorientierung
- 3.3.2.2 Chronologie einzelner Ansätze
- 3.3.3 Das „Eigene“ und das „Fremde“ als Subjektorientierter Zugang zur mittelalterlichen Literatur in der Schule? – Zum Objektfokus der Mittelalterliteraturdidaktik
- 3.3.3.1 Vorüberlegungen
- 3.3.3.2 Zum Themenkanon hinsichtlich des „Eigenen“ und des „Fremden“
- 3.3.3.3 Operationalisierung und Aufgabenstellung zwischen Subjekt- und Objektorientierung
- 3.3.3.4 Kurze Anmerkung zu möglichen weiteren Ursachen des vorwiegenden Objektfokus’ in der Mittelalterliteraturdidaktik
- 3.3.3.5 Auswertung der Unterrichtskonzepte
- 3.3.3.6 Fazit
- 3.3.4 Dezidiert subjektorientierte Ansätze in der Mittelalterliteraturdidaktik
- 3.4 Exkurs zur Phasierungs- und Vermittlungsstruktur als Spiegel von Fachwissenschaft, Objekt- und Subjektbezug
- 3.5 Als Fazit: Wie steht es um das Verhältnis von Subjekt- und Objektorientierung in der Mittelalterliteraturdidaktik?
- 4 Fachwissenschaftliche Überlegungen für eine subjektorientierte Didaktik – „Vereinzelung und Selbstwerdung“ in Wolframs „Parzival“
- 4.1 Vorbemerkung
- 4.1.1 Zum Verhältnis von Sachgegenstand und didaktischem Konzept im Unterricht
- 4.1.2 Zur Suche nach Momenten der figuralen Transformation, ‚Entwicklung‘ und ‚Selbstwerdung‘ im Kontext
- 4.2 Begriff und Zugang – Annäherung an ein ‚Selbst‘ in der Literatur des Mittelalters
- 4.2.1 Ein Differenzierungsversuch – Die mittelalterliche Literatur zwischen Alterität, Universalie und Projektion
- 4.2.2 Ein problematischer Diskurs – Zu „Identität“ und „Individualität“ in der Literatur des Mittelalters
- 4.2.3 Begriffe und Probleme – auf der Suche nach dem Eigenen der Figur und Momenten seiner Transformation
- 4.2.3.1 Unverwechselbarkeit und Transformation
- 4.2.3.2 ‚Lebenslauf‘ und ‚Biografie‘
- 4.2.3.3 „Doppelwegsroman“ und conditio humana – Versuch einer Annäherung
- 4.2.4 Das ‚Innen‘ und das ‚Außen‘ der Helden zwischen Markierung und Leerstelle
- 4.2.5 Ziel der Analyse und ihre Bedeutung für einen subjektorientierten Zugang in der Mittelalterliteraturdidaktik
- 4.3 Vereinzelung und ‚Selbstwerdung‘ in Wolframs „Parzival“
- 4.3.1 Zum arthurischen Erzählkonzept als sinnstiftendem Erzähltypus
- 4.3.2 Kurze Anmerkung zu Scheitern, Krise und Überwindung als anthropologische Reflexion
- 4.3.3 „als agelstern varwe tuot“ – Anmerkung zu literarischem Menschenbild und ‚Biografie‘ in Wolframs Prolog
- 4.3.4 Der Held und seine Ahnen – Parzivals „art“ zwischen Gahmuret und Herzeloyde
- 4.3.5 „er küene, træclîche wîs“ – Zu Parzivals ‚Disposition‘
- 4.3.6 „daz sol iuch witzen næhen“ – Herzeloyde, Gurnemanz und Trevrizent: Parzivals erste Lehrer und ihre Lehren
- 4.3.6.1 ‚Disposition‘ und Lernen – Vorbemerkung zum Verständnis der Lehrersequenzen
- 4.3.6.2 Herzeloydes Lehren und Parzivals Lernen
- 4.3.6.3 Gurnemanz, Parzival und das „verschemen“
- 4.3.6.4 Parzival in Munsalvæsche – Eine Überforderung?
- 4.3.7 Der lange Weg zur Schulderkenntnis – Von Munsalvæsche in die Vereinzelung
- 4.3.7.1 Missverständnis und Isolation
- 4.3.7.2 Die zweite Begegnung mit Sigune – Zwischen den Welten
- 4.3.7.3 Die Blutstropfen im Schnee
- 4.3.7.4 Cundrie, Parzivals Selbstisolation und die Abkehr von Gott
- 4.3.8 „wê waz ist got?“ – Orientierungslosigkeit und „zwîvel“: Parzivals Weg in die Vereinzelung
- 4.3.9 „Ich bin ein man der sünde hât“ – Umkehr, Gespräch mit Trevrizent und der neue „Eigensinn“
- 4.3.9.1 Vorbemerkung
- 4.3.9.2 Die dritte Sigunebegegnung
- 4.3.9.3 Zum Unterschied von Artus- und Gralswelt – Parzivals unfreiwilliger Kampf mit dem Gralsritter
- 4.3.9.4 Kahenis und seine Töchter – Parzivals neuer Umgang mit Gott
- 4.3.9.5 Unter Elsternmenschen – Das „Karfreitagsgespräch“
- 4.3.10 Eine kurze Anmerkung zur Gawan-Episode
- 4.3.11 „mit dir selben hâstu hie gestritn“ – Überwindung, Erlösung und die Utopie der offenen Unvollständigkeit
- 4.3.11.1 Vorbemerkung zur narrativen Struktur des Endes des „Parzival“
- 4.3.11.2 Die Überwindung der Krise als Überwindung des Agons
- 4.3.11.3 Der erste Kampf – Gawan und Parzival
- 4.3.11.4 Der zweite Kampf – Gawan, Gramoflanz und Parzival
- 4.3.11.5 Der dritte Kampf – Parzival, Feirefiz und die Überwindung des „zwîvel“
- 4.4 Zum Abschluss
- 4.4.1 „œheim, waz wirret dir?“
- 4.4.2 Anmerkung zum und Rückbezüge auf den Unterricht
- 5 Wolframs „Parzival“ im Literaturunterricht der 11. Klasse an Waldorfschulen – Ein subjektorientierter Zugang
- 5.1 Zum theoretischen Ansatz der Waldorfpädagogik – Eine Problematisierung
- 5.1.1 Als Vorbemerkung – Zur Intention, den „Parzival“ zu lesen
- 5.1.2 Die theoretische Basis – Zu einem Desiderat
- 5.2 Zur Subjektorientierung im Literaturunterricht der Oberstufe an Waldorfschulen
- 5.2.1 Im Zentrum der Schüler? Zum Selbstverständnis von Anthropologie, Erkenntnisfähigkeit und (Literatur-)Unterricht
- 5.2.2 Individuation, Identitätsbildung und Sinnstiftung im Literaturunterricht
- 5.2.3 ‚Latente Fragen‘ – Anmerkung zu einer anthropologisch begründeten Sinnstiftung im Literaturunterricht
- 5.2.4 Das Verhältnis von Anthropologie und Curriculum als subjektorientiertes Prinzip
- 5.2.5 Zugänge zur Literatur – Zur Bedeutung der Literatur als Medium zur Auseinandersetzung von „Ich“ und „Welt“ im Literaturunterricht
- 5.2.6 Zur „Anthropologie des Erkenntnisaktes“ – Die epistemologischen und intentionalen Grundlagen eines subjektorientierten Unterrichtes
- 5.2.6.1 Vorbemerkung
- 5.2.6.2 Anmerkung zur Epistemologie des dreigliedrigen Unterrichtes
- 5.2.6.3 Epistemologie und Phasierung im Literaturunterricht am Beispiel von Wolframs Gyburc-Monolog
- 5.2.6.3.1 Grundlegung und Ausgangssituation
- 5.2.6.3.2 Schluss
- 5.2.6.3.3 Urteil
- 5.2.6.3.4 Begriff
- 5.2.6.3.5 Bilanz und Anmerkung zur Kontextualisierung
- 5.3 Bilanz eines (nicht) niedergeschriebenen Konzeptes der (Mittelalter-)Literaturdidaktik an Waldorfschulen – Forschungsstand, Intention und Problematisierung
- 5.4 Möglicher Aufbau einer dreiwöchigen subjektorientierten ‚Epoche‘ zu Wolframs „Parzival“
- 5.4.1 Vorbemerkung
- 5.4.2 Anthropologische Annahmen
- 5.4.3 Anmerkung zu den Inhaltsschwerpunkten – Ergänzung zum Kap. 4
- 5.4.4 Eine kurze Skizze didaktischer Überlegungen
- 5.4.5 Synopse und Skizze des Unterrichtsverlaufes
- 6 Als Fazit: Mittelalterliteraturdidaktik und Subjektorientierung an Waldorfschulen
- 6.1 Intention und Alternative – Literaturdidaktik an Waldorfschulen
- 6.2 Die waldorfpädagogische Mittelalterliteraturdidaktik und ihre möglichen Bezüge zum Diskurs
- 6.3 Kurzer Rückbezug auf die eingangs formulierten Desiderate
- Literaturverzeichnis
- Sigelverzeichnis
- Lexika und Nachschlagewerke
- Primärliteratur
- Sekundärliteratur
- Reihenübersicht
1 Einführung, Problemstellung und Zugangsschwierigkeiten
1.1 Vorbemerkung
Die Waldorfschulen sind eine seit 1919 expandierende Institution. Ihre pädagogischen, didaktischen und methodischen Grundlagen resultieren aus den Arbeiten, Anregungen und Veröffentlichungen Rudolf Steiners sowie solchen aus dem waldorfpädagogischen Kontext seit 1919. Die spezielle Lehrerzusatzausbildung basiert neben der herkömmlichen Lehramtsausbildung auch auf Quereinsteigerprogrammen für Menschen mit einer fachbezogenen akademischen Ausbildung. Sie ist eine für die Unterrichtsgenehmigung an Waldorfschulen relevante, staatlich anerkannte pädagogische Zusatzausbildung, die mit einem Seminar-Diplom oder international dem Master im jeweiligen pädagogischen oder didaktischen Schwerpunkt abgeschlossen werden kann. Letzterer wird durch die Freie Hochschule Stuttgart und die Alanus-Hochschule in Alfter sowie von den angegliederten Zweigstellen bspw. in Mannheim, Kassel, Hamburg, Berlin oder Kiel angeboten.
Seit den 1980er Jahren gab es mit den vermehrten Schulgründungen der 1970er Jahre eine zunehmende Kritik an der fachlichen Fundierung der Waldorfpädagogik1. Dies betraf vornehmlich allgemeinpädagogische Aspekte. Die Diskussion fokussierte sich auf den erziehungswissenschaftlichen Bereich. Neben berechtigter und hilfreicher Kritik wurden auch bedenkliche Töne angeschlagen, was so weit führte, dass der Erziehungswissenschaftler Otto Hansmann kritisch anmerkte: „Alles scheint dabei erlaubt zu sein, nur nicht die guten akademischen Sitten“2. Dass sich diese neu entstandene Diskussion sehr spät auf die fachdidaktischen Bereiche erstreckte, lag zumindest für das Fach Deutsch darin begründet, dass sich die Didaktik als akademische Disziplin erst in den 1960ern zu etablieren begann und die Waldorfschulen sowie die Freien Hochschulen in Stuttgart und Dornach als Orte anthroposophischer und waldorfpädagogischer Forschung dieser Entwicklung kaum gefolgt sind. Dies begründet sich einerseits durch ihre vornehmlich phänomenologisch ausgerichtete Epistemologie3, die damals eher als heute dem gängigen methodischen Vorgehen der Wissenschaft folgte, andererseits durch eine divergente Anthropologie4 und die Grundannahme, dass ←15 | 16→formulierte Erziehungsziele, ob nun indoktrinativ oder nur ethisch begründet, eine „Weltanschauungsschule“ ergäben5, was die Waldorfpädagogik in ihren Schriften ablehnt und dem sie das Konzept des „ethischen Individualismus“ entgegenstellt (s.u.). Dass diese Nichtgemeinsamkeiten zu unterschiedlichen Entwicklungen führten, die Waldorfpädagogik ihre Positionen lange nicht angemessen erforschte, lange nicht in eine angemessene und allgemein verständliche Sprache brachte und dadurch in Teilen wie eine Blackbox wirken musste, war zwar nicht zwangsläufig, vor dem Hintergrund der divergenten Ansätze aber auch nicht verwunderlich. Jedoch muss auch die Frage gestellt werden, aus welchem Grund (vornehmlich) die Erziehungswissenschaften sich erst so spät und in einem oft aggressiv-ablehnenden Duktus (s.o.) mit der Waldorfpädagogik beschäftigt haben, was sich trotz aller Berührungsängste vieler Erziehungswissenschaftler6 in den letzten Jahren allerdings zunehmend geändert hat.7
Die heute vorliegenden Grundlagen für den Deutschunterricht an Waldorfschulen wurden aus den allgemeinen Aussagen Steiners und Arbeiten der Lehrerschaft entwickelt. Letztere wurden jedoch insbesondere in einer mündlichen Kultur an den Seminaren weitergegeben, also kaum aufgeschrieben. Einzelne Aspekte wurden zwar in der seit 1927 erscheinenden „Erziehungskunst“, einer zuerst nur intern veröffentlichten waldorfpädagogischen Zeitschrift behandelt, doch sind hier zwischen 1927 und 1964 lediglich 19 Aufsätze zum Literaturunterricht erschienen, von denen nur wenige den Charakter einer didaktischen Selbstverortung, Konzeptidee oder theoretischen Fundierung hatten. Von einem theoretisch legitimierten oder begründeten literaturdidaktischen Konzept an Waldorfschulen konnte und kann also auch heute kaum gesprochen werden, selbst wenn sich seit den 1970er, vorwiegend aber in den 1990er-Jahren etwas bewegt hat.8 Hinzu aber kommt ←16 | 17→ein vordergründig schwieriger Aspekt, und zwar der Umgang einzelner Autoren aus anthroposophischen Zusammenhängen mit mittelalterlichen Werken9 – über Lehrer gibt es hierzu keine Erhebungen -, sowie deren Deutung für die Unterrichtspraxis. Diese Schriften bieten grob gesprochen einen durchweg subjektorientierten, also den (im Sinne der Waldorfpädagogik) individuellen und überindividuellen Schülerbedürfnissen folgenden Zugang an und setzten damit voraus, dass Wolframs „Parzival“ selbstverständlich als ein sogenannter Entwicklungsroman10 gelesen werden könne – und zwar noch heute.11 Hiermit wird offensichtlich, dass eine durch Rudolf Steiner formulierte pädagogische Intention in Bezug auf Wolframs „Parzival“12 ohne weitere Grundlagenforschung oder Integration der jüngeren Forschungsliteratur zugrunde gelegt wird. Dass Steiners Aussagen um 1920, sogar noch in den 1950er-Jahren im Einklang mit dem damaligen Forschungskonsens standen13, wirft einerseits ein positives Licht auf die Fundierung des damaligen Ansatzes – andererseits aber auch ein kritisches auf aktuelle Aussagen, die sich nicht durch Forschungen legitimieren.14 Allein aus diesem Grund gilt es, den in der Waldorfpädagogik verfolgten subjektorientierten Ansatz mit Blick auf die Deutungsmöglichkeiten des Werkes kritisch zu überprüfen – sowohl fachwissenschaftlich als auch hinsichtlich möglicher didaktischer Folgerungen.
Die Ansätze der Waldorfpädagogik deshalb per se infrage zu stellen, würde ihrer Praxis jedoch nicht gerecht werden, denn diese zeigt letztlich ein anderes Bild als die alte und zum Teil auch neuere Kritik. Albert Schmelzer hat dies in seinem Titel zu einer empirischen Studie über das Verhältnis von Theorie und Praxis der Waldorfschule mit einer prägnanten Frage auf den Punkt gebracht: „Gute Praxis – problematische Ideologie?“15 Das Wort Ideologie wird zu klären sein, denn die abweichenden philosophischen, epistemologischen und anthropologischen Annahmen der Waldorfpädagogik ←17 | 18→bedürfen in Bezug auf das herkömmliche Forschungsverständnis eines erweiterten methodischen Blickes. Aus diesem Grund sollen hier vor der Formulierung des Desiderates und des Vorgehens in dieser Arbeit Hinweise auf die genannten Begegnungsschwierigkeiten folgen, um dem jeweils Anderen in seinem Selbstverständnis begegnen und die Aussagen kritisch hinterfragen zu können.
1.2 Ideologie, Anderssein und Begegnungsprobleme – Ein belastetes Terrain
1.2.1 Zu den Schwierigkeiten im Umgang mit anthropologischen Annahmen
Da die Waldorfpädagogik für die Wissenschaft nach wie vor ein schwieriges Terrain ist, liegt es nahe, solche Bereiche, die für diese Arbeit relevant sind, kurz zu paraphrasieren. Dies betrifft insbesondere eine Klärung des Selbstverständnisses und die Auseinandersetzung mit den angesprochenen alternativen Zugängen, die in einer kritischen Untersuchung argumentativ berücksichtigt werden müssen. Obwohl eine Vielzahl historischer Probleme zwischen der universitären Forschung und der Waldorfpädagogik/-didaktik ausführlich aufgearbeitet16 wurde, bleiben nach wie vor viele von Fragen und schwierige Desiderate offen. Diese Schwierigkeiten begründen sich vornehmlich in einem „Anderssein“ der Waldorfpädagogik, das in Teilen auch kritisch betrachtet werden muss.17 Die akademische Initiative der Waldorfpädagogik ist begrüßenswert und ihre Forschungen kontextualisieren sich seit nunmehr fast 30 Jahren zunehmend diskursiv mit den entsprechenden akademischen Studien, doch scheint auch in Teilen der universitären Forschung ein Bewusstsein dafür entstanden zu sein, dass die offene Begegnung mit alternativen Zugängen sinnvoll erscheint. In diesem Sinne argumentiert beispielsweise der Anthropologe und Philosoph Geert Keil, der unabhängig von Anthroposophie oder Waldorfpädagogik eine qualitative wie quantitative Ausdehnung des Diskurses fordert.18 Hiermit liegt er auf einer Linie mit Christoph Wulf und Jörg Zirfas, die dasselbe in Bezug auf die pädagogische Anthropologie anmahnen19 – ein Thema, das für einen Umgang mit der ←18 | 19→Waldorfpädagogik sehr zentral ist und besonders im letzten Abschnitt dieser Untersuchung relevant wird.
Um auf bestehende diskursive Schwierigkeiten und Besonderheiten hinzuweisen, soll zumindest einführend auf die folgenden Aspekte hingewiesen werden, die an vielen Stellen dieser Arbeit wieder in Erscheinung treten. Die historische Entwicklung und der Duktus des Diskurses um die Waldorfpädagogik sowie ihre aktuelle Situation in Bezug auf die Forschung stehen am Beginn dieses Kapitels. Es folgt ein Hinweis zu Rezeptionsformen der bisweilen als problematisch erachteten Steiner’schen Schriften und Vortragswerke. Eine spezifische Epistemologie kann in dieser Schrift zwar nicht systematisch aufgearbeitet werden, allerdings sind Selbstverständnis und Anspruch der Waldorfpädagogik, als vermeintlich theoriefreie Pädagogik20 und Didaktik zu agieren, auch in ihren Widersprüchen zu thematisieren, was punktuell erfolgen wird, wenn es sinnvoll erscheint. Der letzte Punkt in diesem Kapitel, und zwar das sich konzeptionell gegenseitig bedingende Verhältnis von Anthropologie, Pädagogik, Didaktik und Methodik, wird in der akademischen Unterrichtslehre im Regelfall nicht berücksichtigt.21 Dies hat im Selbstverständnis der Waldorfschulen jedoch eine zentrale Bedeutung und muss allein deshalb angesprochen werden. Immerhin: Das Curriculum basiert zumindest dem Anspruch nach auf den anthropologischen Annahmen der Waldorfpädagogik, die dazu dienen, eine sogenannte „menschengemäße“ Pädagogik umsetzen zu können, und zwar auch als Grundlage der Didaktik und Methodik, was jedoch oft genug dargelegt wurde und hier nicht weiter ausgeführt werden muss.
1.2.2 Ablehnung und (Neu-)Begegnung – Die Erforschung der Waldorfschule als Kommunikationsproblem
Ein bisher nur in der Erziehungswissenschaft sowie einzelnen Fachdidaktiken22 aufgearbeitetes Problem ist der Austausch und die Kommunikation zwischen der universitären und der waldorfpädagogischen Perspektive in den Bereichen Anthropologie, Pädagogik und Fachwissenschaft/Didaktik. Dies liegt u.a. daran, dass sich nicht nur die pädagogischen Prinzipien, sondern auch die erkenntnistheoretischen Ansätze, ihre Methoden und Verfahren unterscheiden.23 Vonseiten der Erziehungswissenschaft wurden sie oft ←19 | 20→als inkompatibel mit der eigenen Herangehensweise betrachtet und allein dadurch als inakzeptabel kategorisiert.24 Auch wenn die erste wissenschaftliche Studie zur Waldorfpädagogik, Karl Hövels Dissertation von 1926, dieselbe massiv kritisierte25, begannen die angesprochenen Infragestellungen von akademischer Seite erst in den 1980er-Jahren.26 Auf der einen Seite war diese Kritik mehr durch die Skepsis gegenüber Steiner und einer vermeintlich okkulten Selbstisolation der Waldorfpädagogen geprägt als von einer sachkundigen Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Waldorfpädagogik und ihrer Praxis.27 Auf der anderen Seite schienen diese kritischen Schriften einen überfälligen Diskurs zu begründen und aufseiten der Waldorfpädagogik ein Bewusstsein für die notwendig übergreifende Kommunikation der eigenen Arbeit und ihrer Hintergründe zu schaffen. Sprachliche, begriffliche und inhaltliche sowie methodische Hürden, die zu bewältigen waren, lagen u.a. in den „hämisch belächelten“ „dezidiert spirituelle[n] Grundlagen“28 der Waldorfpädagogik, ihrer abweichenden Anthropologie29 und daraus abgeleitet ihrer eigenen Entwicklungspsychologie.30
So schritt die empirische Unterrichtsforschung an Waldorfschulen voran31, zunehmend Hand in Hand mit der universitären Erziehungswissenschaft, und förderte nicht nur die kooperative und diskursive Arbeit, ←20 | 21→sondern auch ein deutlicheres Bild der Waldorfpädagogik32, und stand den Pauschalvorwürfen von Erziehungswissenschaftlern wie Klaus Prange oder Susanne Lippert33 deutlich entgegen.34 Die Vielzahl der Studien und empirischen Erhebungen zeigen nunmehr ein vollkommen anderes Bild, als es die Kritiker der ersten Stunde zeichneten, und trägt ihren Teil dazu bei, eine differenzierte Diskussion und Bewertung der Waldorfpädagogik vorzunehmen. Auch wenn einzelne als esoterisch verstandene Grundlagen Teil der waldorfpädagogischen Unterrichtskonzepte sind – das vermeintlich schwierige Verhältnis von „problematische[r] Ideologie“ (Schmelzer) und „gute[r] Praxis“ scheint zumindest in der Praxis deutlich weniger relevant zu sein.35 Auch wenn die anthropologischen und philosophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik noch immer umstritten sind und diskutiert werden, kann das Diktum, die Waldorfpädagogik sei per se nicht wissenschaftlich und empirisch untersuchbar, als widerlegt glten. Deshalb wird sich diese literaturdidaktische Arbeit auch nicht mehr grundlegend mit dem Konflikt um die Wissenschaftlichkeit der Waldorfpädagogik auseinandersetzen, sondern sollte als kritisch-konstruktiver Teil der beschriebenen Annäherung verstanden werden.
1.2.3 Rudolf Steiner als Quelle der Waldorfpädagogik
Ein Kernpunkt der Kritik an Waldorfschulen ist, wie bereits ausgeführt, ihre Basis, sind die Schriften Steiners36. Diese werden – neben aktuellen Forschungen – auch heute noch als Grundlage für die Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik angesehen. Der Widerspruch zwischen Kritik und Praxis, wie es 1985 und 2015 Heiner Ullrich37 und aktuell Schmelzer in der empirischen ←21 | 22→Studie „Gute Praxis – problematische Ideologie“38 angedeutet haben, verweist auf die Notwendigkeit, das Selbstverständnis der Waldorfpädagogik im Umgang mit den Schriften Steiners kurz zu thematisieren.
Von waldorfpädagogischer Seite wird immer wieder darauf hingewiesen, dass Steiners Werk einen anderen Charakter habe als gängige Studientexte.39 Seine Sprach- und Konzeptlogik bildet in seinem Selbstverständnis nicht nur einen faktischen und kritisch zu betrachtenden Informationspool für den Leser – so auch Steiner selbst.40 Er warnt vor der Gefahr, anthroposophische Postulate als Grundlage für eine Theorie zu verstehen oder zu nutzen; es dürften lediglich Anregungen für die eigene Weiterarbeit sein.41
Martin Schlüter bezeichnet die Anregungen Steiners als eine „Partitur“ und konstatiert, dass der Rezipient diese „Partitur“ als Interpret oder Koautor eigenverantwortlich durchdringen, ergänzen und umsetzen müsse42. Das bedeutet – auch mit Blick auf die waldorfkritischen Positionen der Erziehungswissenschaft der 1980er und 1990er-Jahre –, dass das Selbstverständnis und die Aussagen Steiners nicht als Dogma verstanden werden dürfen. Auch wenn Teile der waldorfpädagogischen Lehrerschaft einem solchen Diktum nicht folgten, liegt Schlüter in seiner Deutung nahe bei Steiners Aussagen – und widerspricht methodisch zumindest der Kritik am vermeintlichen Epigonalismus der Waldorfpädagogik.43 Auch der Philosoph Ulrich Kaiser hat in seinem Aufsatz zu „Dogma und Methode“44 eine mögliche Dogmatisierung des Werks Steiners problematisiert. Er geht noch weiter und konstatiert, dass eine Dogmatisierung hermeneutisch weder möglich, noch zulässig sei. Der Hermeneutik Jacques Derridas folgend postuliert er, dass Steiners Schriften nicht „Dogma“ im Sinne von Geltung sind, sondern als eigenverantwortliche Begegnung mit der Anthroposophie zu verstehen seien, also einer bestimmten Methode folgen müssten.45 Dass Kaiser mit seiner These nicht alleinsteht, betont auch der Germanist Uwe Pörksen. In seinem Aufsatz „Goethes phänomenologische Naturwissenschaft, Sprache und Darstellung ←22 | 23→als Erkenntnisinstrument“ stellt er den Aufbau der goetheschen Texte und die Verwendung von Sprache als Erkenntnisweg dar und bezeichnet den jungen „Herausgeber von Goethes naturwissenschaftlichem Werk“, Steiner, als „Erfahrungswissenschaftler“, der über den phänomenologischen Ansatz die „Initialzündung“ zu seiner „Anthropologie“ erhielt und die goethesche Erkenntnismethode transformierte.46 Dieser Hinweis von Pörksen geht einher mit der schon länger währenden Diskussion innerhalb der Waldorfpädagogik über die methodischen Zugänge und Grundlagen der Anthroposophie als Basis der Waldorfpädagogik und mit der Forderung, dass die Aussagen Steiners nicht einfach autoritativ verwendet werden dürften. Erkenntnisse und daraus resultierende pädagogische Handlungen müssten das Resultat eines erkenntnistheoretisch begründeten Prozesses sein; die Schriften müssten mit der gebotenen zugewandten Distanz gelesen werden und nicht als esoterische Willkür.47 Um es aus einer ganz anderen philosophischen Richtung mit den Worten Armen Avanessians über das grundsätzliche Verhältnis von Lektüre, Erkenntnis und Kommunikation zu illustrieren:
„Die Frage ist […] nicht mehr, wie die Welt war, sondern ob sie wahr ist, indem ich die Verantwortung übernehme für das, was ich darin jetzt schreibend bin. Wenn ich mich neu in der Welt verorte, wenn ich mich in einer (veränderten) Welt zu lokalisieren verstehe, wenn sich der rekursive Zirkel von Wissen, Singulärem und Allgemeinem zu einem anderen Ganzen geschlossen hat, zu einem ganz anderen Wissen, dann wird sich mein Wissen bewahrheiten.“48
Folglich wird mit Blick auf Steiners Schriften die Frage nach Esoterik und Wissenschaft nicht wichtig für diese Arbeit sein, vielmehr die Herausarbeitung relevanter Ausführungen für eine Literaturdidaktik an Waldorfschulen, um so das erwähnte Selbstverständnis hervorzuheben – soweit es denn formuliert wurde. Dementsprechend kann und soll im Weiteren nicht für jede hier wiedergegebene Aussage eine grundlegende Diskussion über die Qualität von Steiners Schriften geführt werden. Vielmehr soll ihre jeweilige Bedeutung für die Untersuchung und Entwicklung einer Literaturdidaktik in der Oberstufe von Waldorfschulen ermittelt und mit Blick auf die akademische wie waldorfpädagogische Forschung reflektiert werden. Dieser Schritt begründet sich auch in dem Umstand, dass der akademische Diskurs über die Schriften Steiners genauso umfassend wie kontrovers ist und den Rahmen einer literaturdidaktischen Studie deutlich überschreiten würde. Wenn es jedoch von erkenntnistheoretischer, pädagogischer oder didaktischer Seite ←23 | 24→kritische Äußerungen zu den jeweiligen Grundlagen oder anderweitigen Aussagen Steiners gibt, so wird im Rahmen eines übergeordneten Diskurses selbstverständlich auf diese hingewiesen oder werden selbige diskutiert.
1.2.4 Institution und Selbstverständnis
Es mag im Rahmen einer literaturdidaktischen Arbeit vielleicht befremdlich wirken, das institutionelle Selbstverständnis des Untersuchungsgegenstandes zu reflektieren, doch liegt dieser Gedanke näher als zunächst vermutet. Profil und Unterrichtspraxis der staatlichen Schulen, und damit die Grundlinie der Bildungskonzepte, obliegen den Behörden und werden durch die Universitäten oder andere wissenschaftliche Institute bzw. durch die Schulen selbst (Schulprofil) umgesetzt. In diesem Sinne betont Michael Kämper-van den Boogaart am Beispiel der (Deutsch-)Lehrerausbildung, dass die politische Ausrichtung der Institution Schule, die der Institution Universität, die Lehrpläne, Kerncurricula und Lehramtsstudiengänge nicht ein
„Produkt von Wissenschaft und Hochschule sind, sondern die Folge der staatlichen Lehrerprüfungsanordnungen oder Lehrerbildungsgesetze. Als solche erfahren sie ihre Prägung nicht durch Wissenschaft, sondern durch Vorstellungen von Schule und probater schulischer Bildung.“49
Diese institutionellen Bedingungen wirken sich unmittelbar auf die Bildungsstrategien, Curricula und didaktischen Konzepte aus. Allerdings betrachtet Kämper-van den Boogaart dies nicht nur als Einschränkung der pädagogischen und schulischen Praxis, sondern leitet daraus die Notwendigkeit zur Selbstreflexion im Wissenschaftsbetrieb ab, denn, so Kämper-van den Boogaart weiter, diese Vorgaben könnten sich zumindest für den Deutschunterricht auch positiv auswirken.50
Das Verhältnis von Unterrichtspraxis (Pädagogik/Didaktik) und Institution ist also in vielerlei Hinsicht ein sich gegenseitig bedingendes – und dies gilt noch einmal mehr für die Waldorfschulen.51 Eine Untersuchung zur Literaturdidaktik an Waldorfschulen mit ihren eigenen Ansätzen wirkt bisweilen wie die Untersuchung einer als Parallelwelt in Bildungsfragen erlebbaren Einrichtung, deren Anthropologie, Pädagogik, Didaktik und Methodik stark aus eigenen Quellen und einem eigenen Selbstverständnis resultieren. Die äußere Folge ist, trotz der akademischen Fachausbildung der Lehrer, eine ←24 | 25→sehr eigenständig gewachsene Unterrichtspraxis. Aus diesem Grund liegt es nahe, diesen Aspekt am Beginn der Arbeit wenigstens anzudeuten.
Die Waldorfpädagogik entstand aus der sogenannten „Dreigliederungsbewegung“52, die sich als politischer und gesellschaftlicher Reformimpuls verstand. Der Ansatz wurde in einer international aufgelegten programmatischen Schrift Steiners im Jahre 1919 veröffentlicht und war der Versuch, seine philosophischen Positionen als praxisrelevantes Konzept zu formulieren.53 Dieser Ansatz wurde dezidiert in den ersten Waldorf-Schulgründungsimpuls durch den Industriellen Emil Molt einbezogen und es entstand ein weiterer Weg in der Vielfalt reformpädagogischer Strömungen. Im Vordergrund stand das spezifische Selbstverständnis als eine selbstverwaltete, freie „Methodenschule“54, die sich, wie andere Reformbestrebungen auch, radikal gegen eine politische Funktionalisierung und Vereinnahmung der Schüler durch Ideologien und Erziehungsziele wie bspw. solche des Wilhelminismus oder des Sozialismus wenden wollte. Diese ideologischen Übergriffe zugunsten weltanschaulicher Prägungen und auf Kosten einer freien individuellen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bezeichnete Steiner als „Weltanschauungsschule“55 – ein Umstand, der in den Erziehungswissenschaften auch für die heutigen Schulen noch problematisiert wird.56 Damit stand die Waldorfschule als reformpädagogische Strömung zwar nicht allein57, tat dies aber mit abweichenden anthropologischen und epistemologischen Prämissen.
Der auch heute hochgehaltene Anspruch der Waldorfschulen ist erstens die sogenannte „Erziehung zur Freiheit“58 in Form einer anthropologisch begründeten Pädagogik, die für sich in Anspruch nimmt, vom Menschen und nicht von einer Idee auszugehen, zweitens ein selbstverwalteter Organismus, der nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Staat steht.59 Der erste Punkt folgt einem systematischen pädagogischen Programm und wird mit ←25 | 26→dem Begriff „Ethischer Individualismus“ beschrieben.60 Dieser entspringt der philosophischen Grundsatzschrift Steiners, der „Philosophie der Freiheit“ von 1886, und charakterisiert mit entsprechenden Folgestudien bis heute nicht nur das spezifische Freiheitsbild der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik, sondern auch ein Verfahren im Unterricht (das hinsichtlich der Literaturdidaktik im 5. Kapitel noch näher erläutert werden wird).61 Dass der zweite Punkt schon 1919 politisch und gesellschaftlich utopisch war, lässt sich ebenso in den Konferenzprotokollen der ersten Waldorfschulen ablesen62 wie im ersten Lehrplan der Waldorfschulen. Hier schreibt Caroline von Heydebrand 1925:
„Zu dieser Wirklichkeit (den schulpraktischen Bedingungen, F.S.) gehört vieles: es gehört zu ihr die Individualität des Lehrers, der einer Klasse gegenübersteht, es gehört zu ihr die Klasse selbst mit der ganzen Eigenart jedes einzelnen Schülers, es gehört zu ihr die weltgeschichtliche Zeit und der bestimmte Ort der Erde mit seinen eigenen Schulgesetzen und Schulbehörden, an dem die Schule steht, die den Lehrplan verwirklichen will. Alle diese Gegebenheiten modifizieren den idealen Lehrplan und fordern Wandlungen und Verständigungen, und die Erziehungsaufgabe, die uns vom Wesen der Heranwachsenden gestellt ist, kann nur gelöst werden, wenn der Lehrplan in sich selbst Beweglichkeit und Bildsamkeit hat.“63
Deutlich wird hier die Erkenntnis, nicht in einem luftleeren Raum zu agieren, sondern auch im Kontext der Gesellschaft den Bedürfnissen des Kindes gerecht werden zu müssen bzw. zu wollen.
Details
- Seiten
- 538
- Jahr
- 2022
- ISBN (PDF)
- 9783631879689
- ISBN (ePUB)
- 9783631879696
- ISBN (MOBI)
- 9783631879702
- ISBN (Hardcover)
- 9783631879603
- DOI
- 10.3726/b19800
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2022 (August)
- Erschienen
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 538 S.