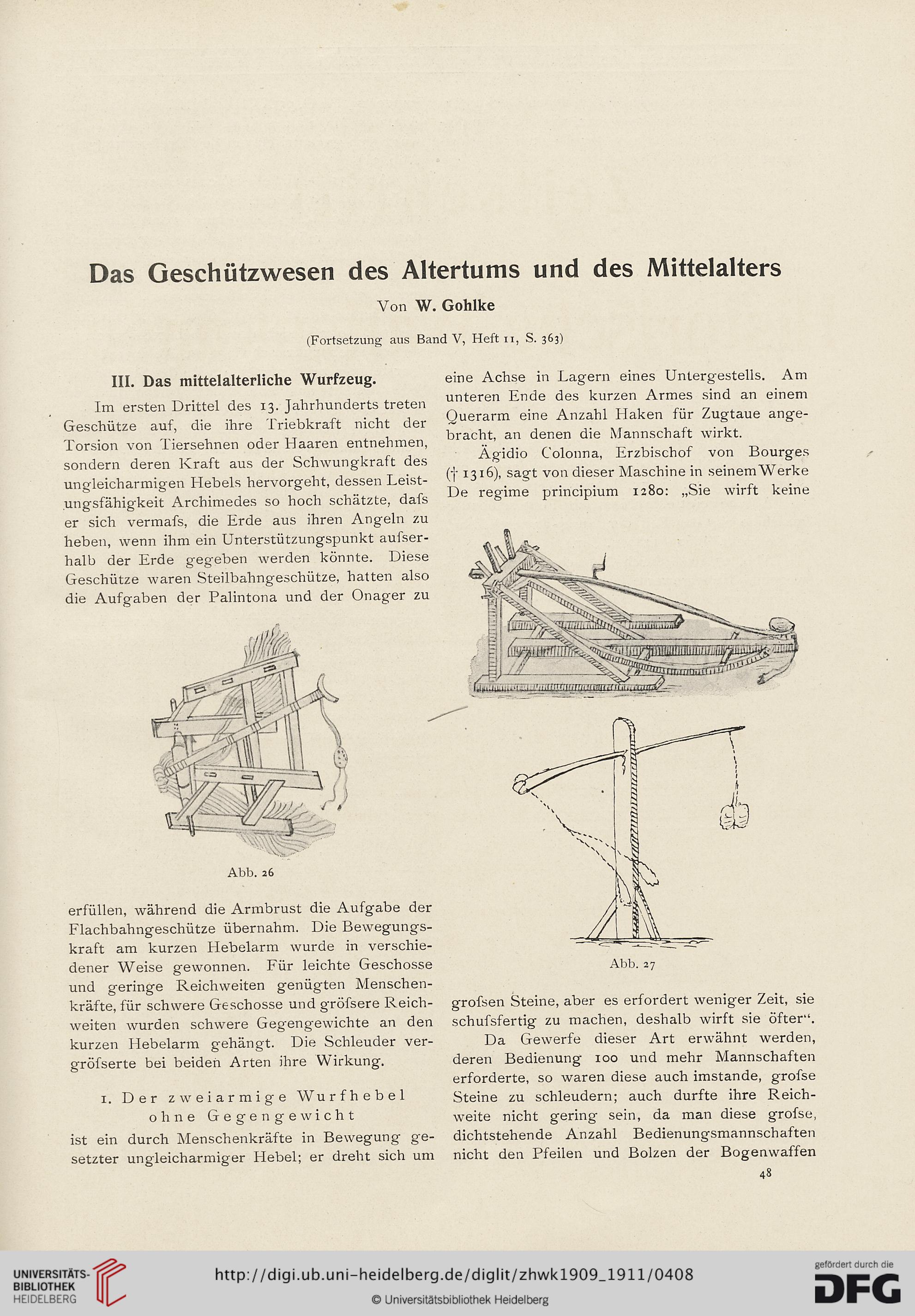Das Geschützwesen des Altertums und des Mittelalters
Von W. Gohlke
(Fortsetzung aus Band V, Heft 11, S. 363)
III. Das mittelalterliche Wurfzeug.
Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts treten
Geschütze auf, die ihre Triebkraft nicht der
Torsion von Tiersehnen oder Haaren entnehmen,
sondern deren Kraft aus der Schwungkraft des
ungleicharmigen Hebels hervorgeht, dessen Leist-
ungsfähigkeit Archimedes so hoch schätzte, dafs
er sich vermafs, die Erde aus ihren Angeln zu
heben, wenn ihm ein Unterstützungspunkt aufser-
halb der Erde gegeben werden könnte. Diese
Geschütze waren Steilbahngeschütze, hatten also
die Aufgaben der Palintona und der Onager zu
erfüllen, während die Armbrust die Aufgabe der
Flachbahngeschütze übernahm. Die Bewegungs-
kraft am kurzen Hebelarm wurde in verschie-
dener Weise gewonnen. Für leichte Geschosse
und geringe Reichweiten genügten Menschen-
kräfte, für schwere Geschosse und gröfsere Reich-
weiten wurden schwere Gegengewichte an den
kurzen Hebelarm gehängt. Die Schleuder ver-
gröfserte bei beiden Arten ihre Wirkung.
1. Der zweiarmige Wurfhebel
ohne Gegengewicht
ist ein durch Menschenkräfte in Bewegung ge-
setzter ungleicharmiger Hebel; er dreht sich um
eine Achse in Lagern eines Untergestells. Am
unteren Ende des kurzen Armes sind an einem
Querarm eine Anzahl Haken für Zugtaue ange-
bracht, an denen die Mannschaft wirkt.
Ägidio Colonna, Erzbischof von Bourges
(f 1316), sagt von dieser Maschine in seinemWerke
De regime principium 1280: „Sie wirft keine
grofsen Steine, aber es erfordert weniger Zeit, sie
schufsfertig zu machen, deshalb wirft sie öfter“.
Da Gewerfe dieser Art erwähnt werden,
deren Bedienung 100 und mehr Mannschaften
erforderte, so waren diese auch imstande, grofse
Steine zu schleudern; auch durfte ihre Reich-
weite nicht gering sein, da man diese grofse,
dichtstehende Anzahl Bedienungsmannschaften
nicht den Pfeilen und Bolzen der Bogenwaffen
48
Von W. Gohlke
(Fortsetzung aus Band V, Heft 11, S. 363)
III. Das mittelalterliche Wurfzeug.
Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts treten
Geschütze auf, die ihre Triebkraft nicht der
Torsion von Tiersehnen oder Haaren entnehmen,
sondern deren Kraft aus der Schwungkraft des
ungleicharmigen Hebels hervorgeht, dessen Leist-
ungsfähigkeit Archimedes so hoch schätzte, dafs
er sich vermafs, die Erde aus ihren Angeln zu
heben, wenn ihm ein Unterstützungspunkt aufser-
halb der Erde gegeben werden könnte. Diese
Geschütze waren Steilbahngeschütze, hatten also
die Aufgaben der Palintona und der Onager zu
erfüllen, während die Armbrust die Aufgabe der
Flachbahngeschütze übernahm. Die Bewegungs-
kraft am kurzen Hebelarm wurde in verschie-
dener Weise gewonnen. Für leichte Geschosse
und geringe Reichweiten genügten Menschen-
kräfte, für schwere Geschosse und gröfsere Reich-
weiten wurden schwere Gegengewichte an den
kurzen Hebelarm gehängt. Die Schleuder ver-
gröfserte bei beiden Arten ihre Wirkung.
1. Der zweiarmige Wurfhebel
ohne Gegengewicht
ist ein durch Menschenkräfte in Bewegung ge-
setzter ungleicharmiger Hebel; er dreht sich um
eine Achse in Lagern eines Untergestells. Am
unteren Ende des kurzen Armes sind an einem
Querarm eine Anzahl Haken für Zugtaue ange-
bracht, an denen die Mannschaft wirkt.
Ägidio Colonna, Erzbischof von Bourges
(f 1316), sagt von dieser Maschine in seinemWerke
De regime principium 1280: „Sie wirft keine
grofsen Steine, aber es erfordert weniger Zeit, sie
schufsfertig zu machen, deshalb wirft sie öfter“.
Da Gewerfe dieser Art erwähnt werden,
deren Bedienung 100 und mehr Mannschaften
erforderte, so waren diese auch imstande, grofse
Steine zu schleudern; auch durfte ihre Reich-
weite nicht gering sein, da man diese grofse,
dichtstehende Anzahl Bedienungsmannschaften
nicht den Pfeilen und Bolzen der Bogenwaffen
48