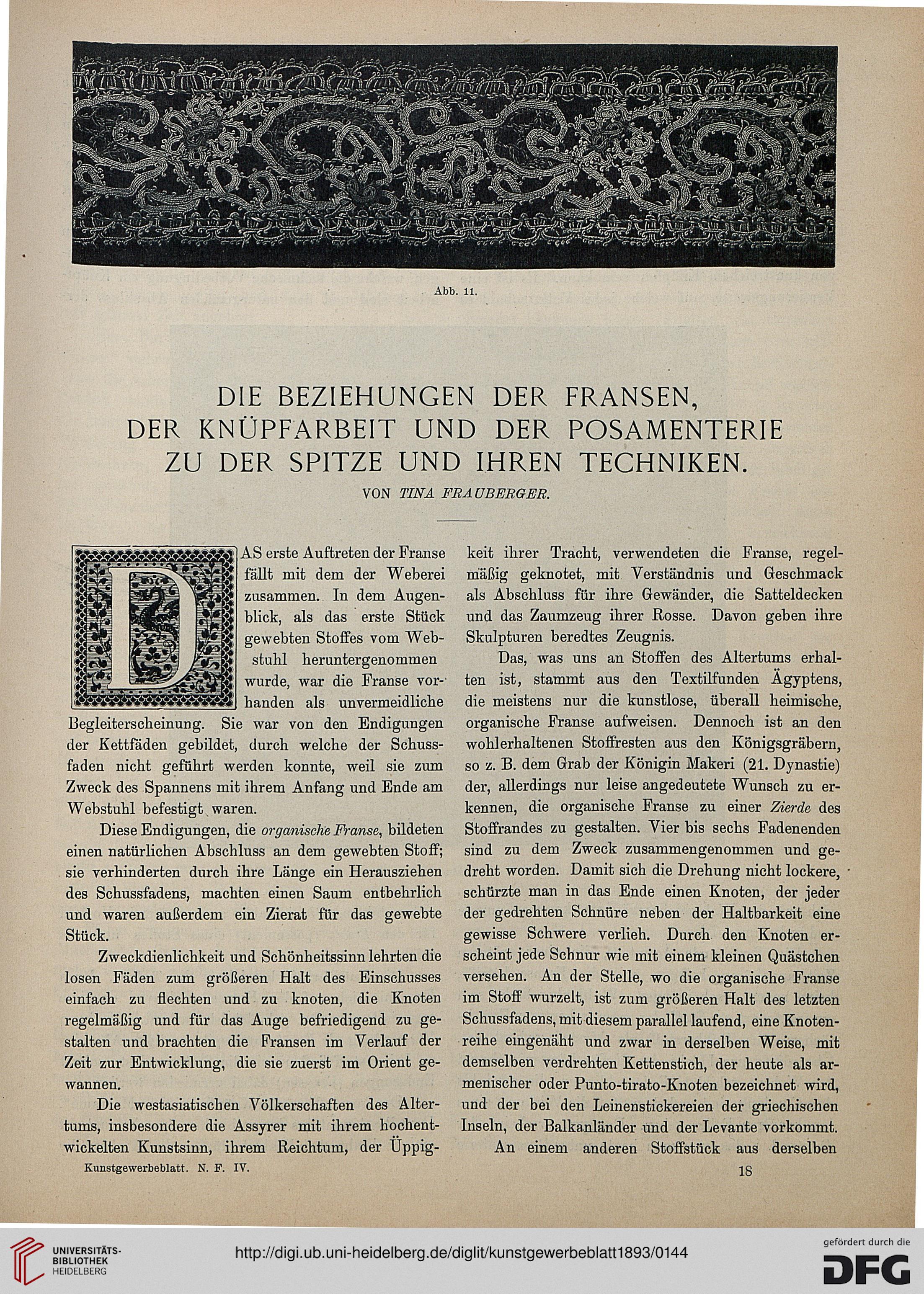Abb. 11.
DIE BEZIEHUNGEN DER FRANSEN,
DER KNÜPFARBEIT UND DER POSAMENTERIE
ZU DER SPITZE UND IHREN TECHNIKEN.
VON TINA FRAUBEBGER.
fSWÜV«
AS erste Auftreten der Franse
fällt mit dem der Weberei
zusammen. In dem Augen-
blick, als das erste Stück
gewebten Stoffes vom Web-
stuhl heruntergenommen
wurde, war die Franse vor--
handen als unvermeidliche
Begleiterscheinung. Sie war von den Endigungen
der Kettfäden gebildet, durch welche der Schuss-
faden nicht geführt werden konnte, weil sie zum
Zweck des Spannens mit ihrem Anfang und Ende am
Webstuhl befestigt waren.
Diese Endigungen, die organische Franse, bildeten
einen natürlichen Abschluss an dem gewebten Stoff;
sie verhinderten durch ihre Länge ein Herausziehen
des Schussfadens, machten einen Saum entbehrlich
und waren außerdem ein Zierat für das gewebte
Stück.
Zweckdienlichkeit und Schönheitssinn lehrten die
losen Fäden zum größeren Halt des Einschusses
einfach zu flechten und zu knoten, die Knoten
regelmäßig und für das Auge befriedigend zu ge-
stalten und brachten die Fransen im Verlauf der
Zeit zur Entwicklung, die sie zuerst im Orient ge-
wannen.
Die westasiatischen Völkerschaften des Alter-
tums, insbesondere die Assyrer mit ihrem hochent-
wickelten Kunstsinn, ihrem Reichtum, der Uppig-
Kunstgewerbeblatt. N. F. IV.
keit ihrer Tracht, verwendeten die Franse, regel-
mäßig geknotet, mit Verständnis und Geschmack
als Abschluss für ihre Gewänder, die Satteldecken
und das Zaumzeug ihrer Rosse. Davon geben ihre
Skulpturen beredtes Zeugnis.
Das, was uns an Stoffen des Altertums erhal-
ten ist, stammt aus den Textilfunden Ägyptens,
die meistens nur die kunstlose, überall heimische,
organische Franse aufweisen. Dennoch ist an den
wohl erhaltenen Stoffresten aus den Königsgräbern,
so z. B. dem Grab der Königin Makeri (21. Dynastie)
der, allerdings nur leise angedeutete Wunsch zu er-
kennen, die organische Franse zu einer Zierde des
Stoffrandes zu gestalten. Vier bis sechs Fadenenden
sind zu dem Zweck zusammengenommen und ge-
dreht worden. Damit sich die Drehung nicht lockere, ■
schürzte man in das Ende einen Knoten, der jeder
der gedrehten Schnüre neben der Haltbarkeit eine
gewisse Schwere verlieh. Durch den Knoten er-
scheint jede Schnur wie mit einem kleinen Quästchen
versehen. An der Stelle, wo die organische Franse
im Stoff wurzelt, ist zum größeren Halt des letzten
Schussfadens, mit diesem parallel laufend, eine Knoten-
reihe eingenäht und zwar in derselben Weise, mit
demselben verdrehten Kettenstich, der heute als ar-
menischer oder Punto-tirato-Knoten bezeichnet wird,
und der bei den Leinenstickereien der griechischen
Inseln, der Balkanländer und der Levante vorkommt.
An einem anderen Stoffstück aus derselben
18
DIE BEZIEHUNGEN DER FRANSEN,
DER KNÜPFARBEIT UND DER POSAMENTERIE
ZU DER SPITZE UND IHREN TECHNIKEN.
VON TINA FRAUBEBGER.
fSWÜV«
AS erste Auftreten der Franse
fällt mit dem der Weberei
zusammen. In dem Augen-
blick, als das erste Stück
gewebten Stoffes vom Web-
stuhl heruntergenommen
wurde, war die Franse vor--
handen als unvermeidliche
Begleiterscheinung. Sie war von den Endigungen
der Kettfäden gebildet, durch welche der Schuss-
faden nicht geführt werden konnte, weil sie zum
Zweck des Spannens mit ihrem Anfang und Ende am
Webstuhl befestigt waren.
Diese Endigungen, die organische Franse, bildeten
einen natürlichen Abschluss an dem gewebten Stoff;
sie verhinderten durch ihre Länge ein Herausziehen
des Schussfadens, machten einen Saum entbehrlich
und waren außerdem ein Zierat für das gewebte
Stück.
Zweckdienlichkeit und Schönheitssinn lehrten die
losen Fäden zum größeren Halt des Einschusses
einfach zu flechten und zu knoten, die Knoten
regelmäßig und für das Auge befriedigend zu ge-
stalten und brachten die Fransen im Verlauf der
Zeit zur Entwicklung, die sie zuerst im Orient ge-
wannen.
Die westasiatischen Völkerschaften des Alter-
tums, insbesondere die Assyrer mit ihrem hochent-
wickelten Kunstsinn, ihrem Reichtum, der Uppig-
Kunstgewerbeblatt. N. F. IV.
keit ihrer Tracht, verwendeten die Franse, regel-
mäßig geknotet, mit Verständnis und Geschmack
als Abschluss für ihre Gewänder, die Satteldecken
und das Zaumzeug ihrer Rosse. Davon geben ihre
Skulpturen beredtes Zeugnis.
Das, was uns an Stoffen des Altertums erhal-
ten ist, stammt aus den Textilfunden Ägyptens,
die meistens nur die kunstlose, überall heimische,
organische Franse aufweisen. Dennoch ist an den
wohl erhaltenen Stoffresten aus den Königsgräbern,
so z. B. dem Grab der Königin Makeri (21. Dynastie)
der, allerdings nur leise angedeutete Wunsch zu er-
kennen, die organische Franse zu einer Zierde des
Stoffrandes zu gestalten. Vier bis sechs Fadenenden
sind zu dem Zweck zusammengenommen und ge-
dreht worden. Damit sich die Drehung nicht lockere, ■
schürzte man in das Ende einen Knoten, der jeder
der gedrehten Schnüre neben der Haltbarkeit eine
gewisse Schwere verlieh. Durch den Knoten er-
scheint jede Schnur wie mit einem kleinen Quästchen
versehen. An der Stelle, wo die organische Franse
im Stoff wurzelt, ist zum größeren Halt des letzten
Schussfadens, mit diesem parallel laufend, eine Knoten-
reihe eingenäht und zwar in derselben Weise, mit
demselben verdrehten Kettenstich, der heute als ar-
menischer oder Punto-tirato-Knoten bezeichnet wird,
und der bei den Leinenstickereien der griechischen
Inseln, der Balkanländer und der Levante vorkommt.
An einem anderen Stoffstück aus derselben
18