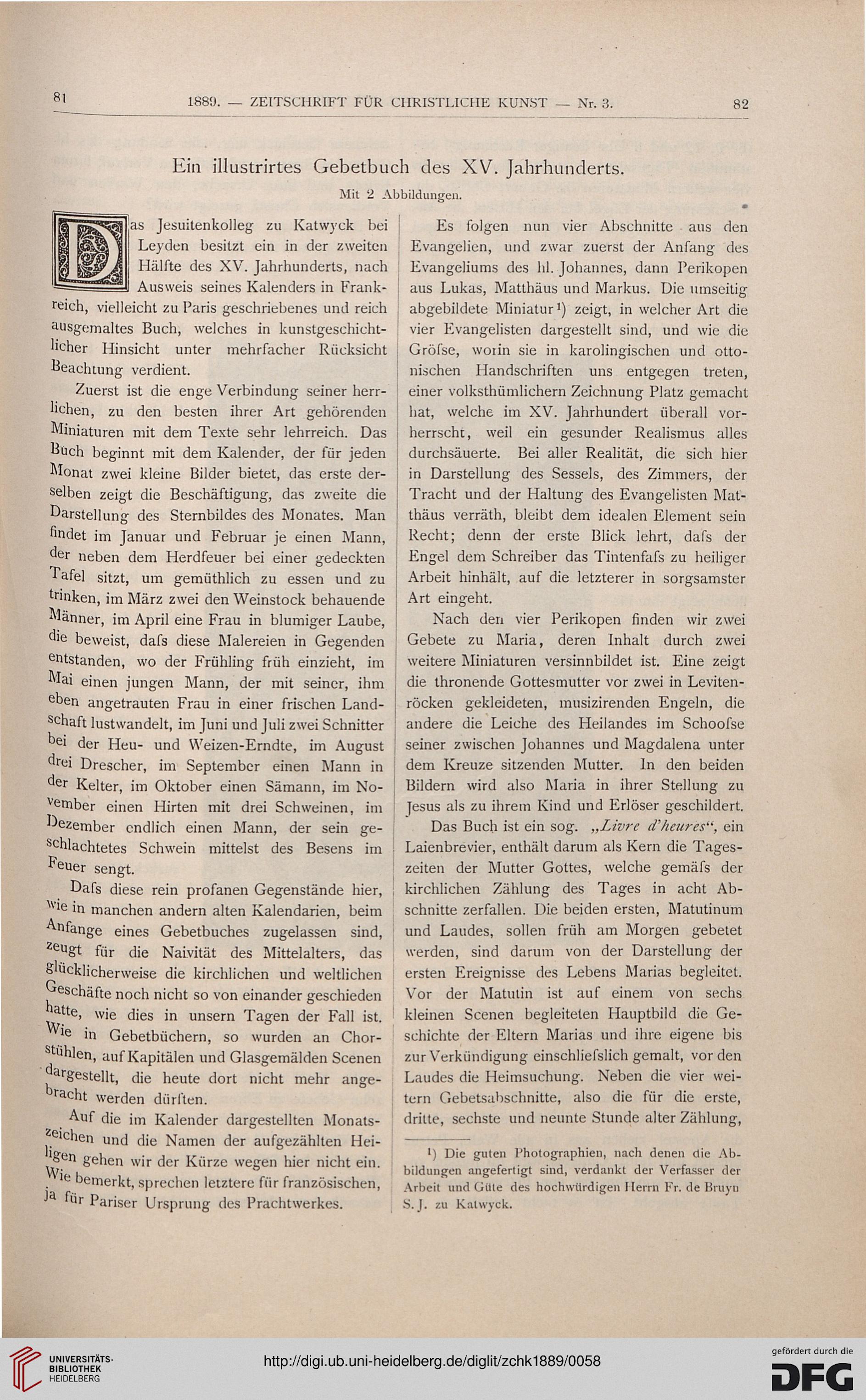1880.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 3.
82
Ein illustrirtes Gebetbuch des XV. Jahrhunderts.
Mit 2 Abbildungen.
as Jesuitenkolleg zu Katwyck bei
Leyden besitzt ein in der zweiten
Hälfte des XV. Jahrhunderts, nach
Ausweis seines Kalenders in Frank-
reich, vielleicht zu Paris geschriebenes und reich
ausgemaltes Buch, welches in kunstgeschicht-
licher Hinsicht unter mehrfacher Rücksicht
Beachtung verdient.
Zuerst ist die enge Verbindung seiner herr-
wehen, zu den besten ihrer Art gehörenden
Miniaturen mit dem Texte sehr lehrreich. Das
Buch beginnt mit dem Kalender, der für jeden
Monat zwei kleine Bilder bietet, das erste der-
selben zeigt die Beschäftigung, das zweite die
Darstellung des Sternbildes des Monates. Man
findet im Januar und Februar je einen Mann,
der neben dem Herdfeuer bei einer gedeckten
Tafel sitzt, um gemüthlich zu essen und zu
trinken, im März zwei den Weinstock behauende
Männer, im April eine Frau in blumiger Laube,
die beweist, dafs diese Malereien in Gegenden
entstanden, wo der Frühling früh einzieht, im
Mai einen jungen Mann, der mit seiner, ihm
eben angetrauten Frau in einer frischen Land-
schaft lustwandelt, im Juni und Juli zwei Schnitter
bei der Heu- und Weizen-Erndte, im August
drei Drescher, im September einen Mann in
fler Kelter, im Oktober einen Sämann, im No-
vember einen Hirten mit drei Schweinen, im
J-*ezember endlich einen Mann, der sein ge-
schlachtetes Schwein mittelst des Besens im
Feuer sengt.
Dafs diese rein profanen Gegenstände hier,
Wle in manchen andern alten Kaiendarien, beim
•anfange eines Gebetbuches zugelassen sind,
2eugt für die Naivität des Mittelalters, das
glücklicherweise die kirchlichen und weltlichen
eschäfte noch nicht so von einander geschieden
atte, wie dies in unsern Tagen der Fall ist.
le in Gebetbüchern, so wurden an Chor-
älen, auf Kapitalen und Glasgemälden Scenen
^•"gestellt, die heute dort nicht mehr ange-
bracht werden dürften.
Auf die im Kalender dargestellten Monats-
eichen und die Namen der aufgezählten Hei-
gen gehen wir der Kürze wegen hier nicht ein.
>e bemerkt, sprechen letztere für französischen,
Ja für Pariser Ursprung des Prachtwerkes.
Es folgen nun vier Abschnitte aus den
Evangelien, und zwar zuerst der Anfang des
Evangeliums des hl. Johannes, dann Perikopen
aus Lukas, Matthäus und Markus. Die umseitig
abgebildete Miniatur1) zeigt, in welcher Art die
vier Evangelisten dargestellt sind, und wie die
Gröfse, worin sie in karolingischen und otto-
nischen Handschriften uns entgegen treten,
einer volksthümlichern Zeichnung Platz gemacht
hat, welche im XV. Jahrhundert überall vor-
herrscht, weil ein gesunder Realismus alles
durchsäuerte. Bei aller Realität, die sich hier
in Darstellung des Sessels, des Zimmers, der
Tracht und der Haltung des Evangelisten Mat-
thäus verräth, bleibt dem idealen Element sein
Recht; denn der erste Blick lehrt, dafs der
Engel dem Schreiber das Tintenfafs zu heiliger
Arbeit hinhält, auf die letzterer in sorgsamster
Art eingeht.
Nach den vier Perikopen finden wir zwei
Gebete zu Maria, deren Inhalt durch zwei
weitere Miniaturen versinnbildet ist. Eine zeigt
die thronende Gottesmutter vor zwei in Leviten-
röcken gekleideten, musizirenden Engeln, die
andere die Leiche des Heilandes im Schoofse
seiner zwischen Johannes und Magdalena unter
dem Kreuze sitzenden Mutter. In den beiden
Bildern wird also Maria in ihrer Stellung zu
Jesus als zu ihrem Kind und Erlöser geschildert.
Das Buch ist ein sog. „Livrc d'keures", ein
Laienbrevier, enthält darum als Kern die Tages-
zeiten der Mutter Gottes, welche gemäfs der
kirchlichen Zählung des Tages in acht Ab-
schnitte zerfallen. Die beiden ersten, Matutinum
und Landes, sollen früh am Morgen gebetet
werden, sind darum von der Darstellung der
ersten Ereignisse des Lebens Marias begleitet.
Vor der Matutin ist auf einem von sechs
kleinen Scenen begleiteten Hauptbild die Ge-
schichte der Eltern Marias und ihre eigene bis
zur Verkündigung einschliefslich gemalt, vor den
Landes die Heimsuchung. Neben die vier wei-
tem Gebetsabschnitte, also die für die erste,
dritte, sechste und neunte Stunde alter Zählung,
') Die guten Photographien, nach denen die Ab-
bildungen angefertigt sind, verdank! der Verfasser der
Arbeit und Güte des hochwürdigen Herrn Fr. de Bruyn
S. J. zu Katwyck.
ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST
Nr. 3.
82
Ein illustrirtes Gebetbuch des XV. Jahrhunderts.
Mit 2 Abbildungen.
as Jesuitenkolleg zu Katwyck bei
Leyden besitzt ein in der zweiten
Hälfte des XV. Jahrhunderts, nach
Ausweis seines Kalenders in Frank-
reich, vielleicht zu Paris geschriebenes und reich
ausgemaltes Buch, welches in kunstgeschicht-
licher Hinsicht unter mehrfacher Rücksicht
Beachtung verdient.
Zuerst ist die enge Verbindung seiner herr-
wehen, zu den besten ihrer Art gehörenden
Miniaturen mit dem Texte sehr lehrreich. Das
Buch beginnt mit dem Kalender, der für jeden
Monat zwei kleine Bilder bietet, das erste der-
selben zeigt die Beschäftigung, das zweite die
Darstellung des Sternbildes des Monates. Man
findet im Januar und Februar je einen Mann,
der neben dem Herdfeuer bei einer gedeckten
Tafel sitzt, um gemüthlich zu essen und zu
trinken, im März zwei den Weinstock behauende
Männer, im April eine Frau in blumiger Laube,
die beweist, dafs diese Malereien in Gegenden
entstanden, wo der Frühling früh einzieht, im
Mai einen jungen Mann, der mit seiner, ihm
eben angetrauten Frau in einer frischen Land-
schaft lustwandelt, im Juni und Juli zwei Schnitter
bei der Heu- und Weizen-Erndte, im August
drei Drescher, im September einen Mann in
fler Kelter, im Oktober einen Sämann, im No-
vember einen Hirten mit drei Schweinen, im
J-*ezember endlich einen Mann, der sein ge-
schlachtetes Schwein mittelst des Besens im
Feuer sengt.
Dafs diese rein profanen Gegenstände hier,
Wle in manchen andern alten Kaiendarien, beim
•anfange eines Gebetbuches zugelassen sind,
2eugt für die Naivität des Mittelalters, das
glücklicherweise die kirchlichen und weltlichen
eschäfte noch nicht so von einander geschieden
atte, wie dies in unsern Tagen der Fall ist.
le in Gebetbüchern, so wurden an Chor-
älen, auf Kapitalen und Glasgemälden Scenen
^•"gestellt, die heute dort nicht mehr ange-
bracht werden dürften.
Auf die im Kalender dargestellten Monats-
eichen und die Namen der aufgezählten Hei-
gen gehen wir der Kürze wegen hier nicht ein.
>e bemerkt, sprechen letztere für französischen,
Ja für Pariser Ursprung des Prachtwerkes.
Es folgen nun vier Abschnitte aus den
Evangelien, und zwar zuerst der Anfang des
Evangeliums des hl. Johannes, dann Perikopen
aus Lukas, Matthäus und Markus. Die umseitig
abgebildete Miniatur1) zeigt, in welcher Art die
vier Evangelisten dargestellt sind, und wie die
Gröfse, worin sie in karolingischen und otto-
nischen Handschriften uns entgegen treten,
einer volksthümlichern Zeichnung Platz gemacht
hat, welche im XV. Jahrhundert überall vor-
herrscht, weil ein gesunder Realismus alles
durchsäuerte. Bei aller Realität, die sich hier
in Darstellung des Sessels, des Zimmers, der
Tracht und der Haltung des Evangelisten Mat-
thäus verräth, bleibt dem idealen Element sein
Recht; denn der erste Blick lehrt, dafs der
Engel dem Schreiber das Tintenfafs zu heiliger
Arbeit hinhält, auf die letzterer in sorgsamster
Art eingeht.
Nach den vier Perikopen finden wir zwei
Gebete zu Maria, deren Inhalt durch zwei
weitere Miniaturen versinnbildet ist. Eine zeigt
die thronende Gottesmutter vor zwei in Leviten-
röcken gekleideten, musizirenden Engeln, die
andere die Leiche des Heilandes im Schoofse
seiner zwischen Johannes und Magdalena unter
dem Kreuze sitzenden Mutter. In den beiden
Bildern wird also Maria in ihrer Stellung zu
Jesus als zu ihrem Kind und Erlöser geschildert.
Das Buch ist ein sog. „Livrc d'keures", ein
Laienbrevier, enthält darum als Kern die Tages-
zeiten der Mutter Gottes, welche gemäfs der
kirchlichen Zählung des Tages in acht Ab-
schnitte zerfallen. Die beiden ersten, Matutinum
und Landes, sollen früh am Morgen gebetet
werden, sind darum von der Darstellung der
ersten Ereignisse des Lebens Marias begleitet.
Vor der Matutin ist auf einem von sechs
kleinen Scenen begleiteten Hauptbild die Ge-
schichte der Eltern Marias und ihre eigene bis
zur Verkündigung einschliefslich gemalt, vor den
Landes die Heimsuchung. Neben die vier wei-
tem Gebetsabschnitte, also die für die erste,
dritte, sechste und neunte Stunde alter Zählung,
') Die guten Photographien, nach denen die Ab-
bildungen angefertigt sind, verdank! der Verfasser der
Arbeit und Güte des hochwürdigen Herrn Fr. de Bruyn
S. J. zu Katwyck.