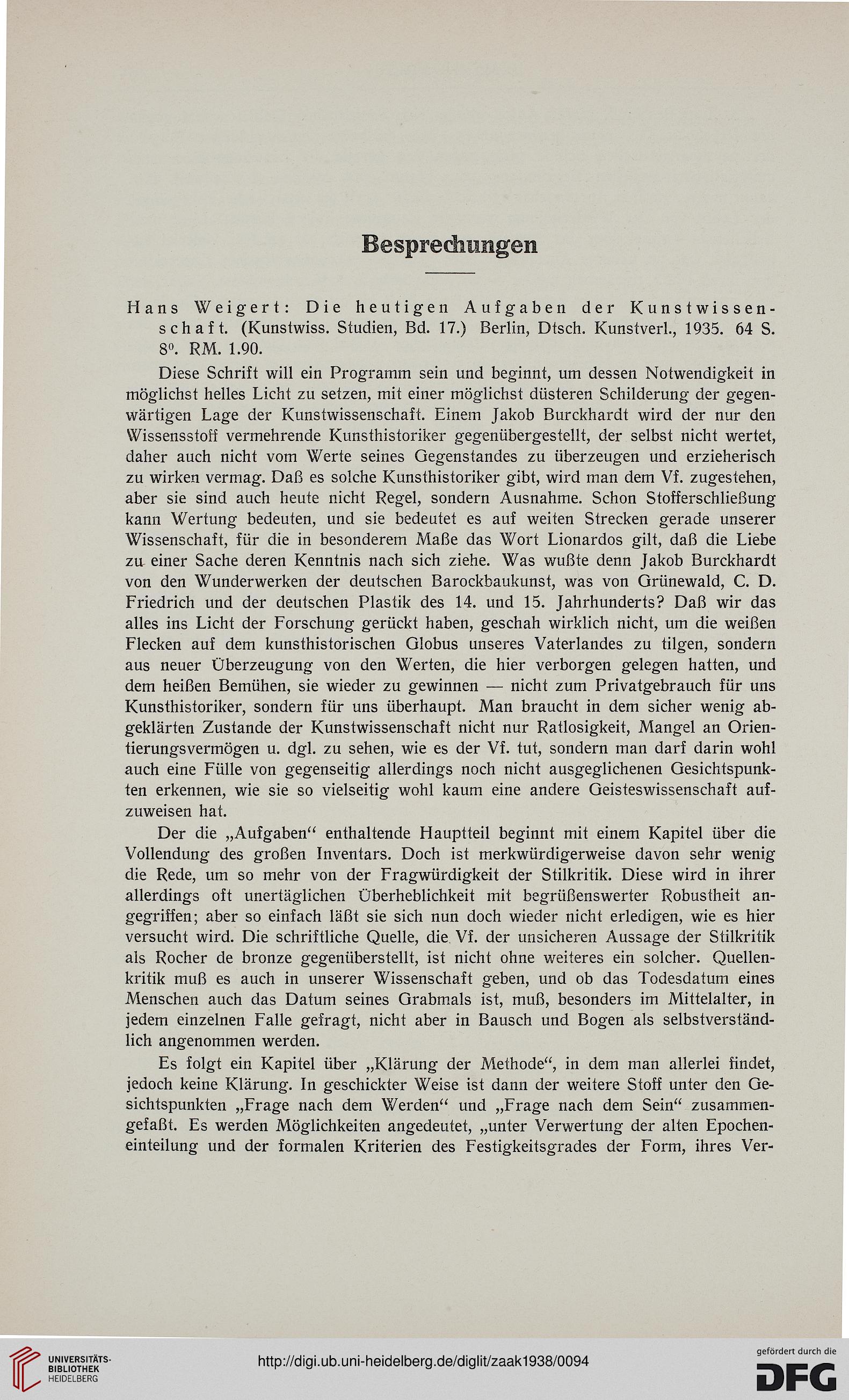Hans Weigert: Die heutigen Aufgaben der Kunstwissen-
schaft. (Kunstwiss. Studien, Bd. 17.) Berlin, Dtsch. Kunstverl., 1935. 64 S.
8°. RM. 1.90.
Diese Schrift will ein Programm sein und beginnt, um dessen Notwendigkeit in
möglichst helles Licht zu setzen, mit einer möglichst düsteren Schilderung der gegen-
wärtigen Lage der Kunstwissenschaft. Einem Jakob Burckhardt wird der nur den
Wissensstoff vermehrende Kunsthistoriker gegenübergestellt, der selbst nicht wertet,
daher auch nicht vom Werte seines Gegenstandes zu überzeugen und erzieherisch
zu wirken vermag. Daß es solche Kunsthistoriker gibt, wird man dem Vf. zugestehen,
aber sie sind auch heute nicht Regel, sondern Ausnahme. Schon Stofferschließung
kann Wertung bedeuten, und sie bedeutet es auf weiten Strecken gerade unserer
Wissenschaft, für die in besonderem Maße das Wort Lionardos gilt, daß die Liebe
zu einer Sache deren Kenntnis nach sich ziehe. Was wußte denn Jakob Burckhardt
von den Wunderwerken der deutschen Barockbaukunst, was von Grünewald, C. D.
Friedrich und der deutschen Plastik des 14. und 15. Jahrhunderts? Daß wir das
alles ins Licht der Forschung gerückt haben, geschah wirklich nicht, um die weißen
Flecken auf dem kunsthistorischen Globus unseres Vaterlandes zu tilgen, sondern
aus neuer Überzeugung von den Werten, die hier verborgen gelegen hatten, und
dem heißen Bemühen, sie wieder zu gewinnen — nicht zum Privatgebrauch für uns
Kunsthistoriker, sondern für uns überhaupt. Man braucht in dem sicher wenig ab-
geklärten Zustande der Kunstwissenschaft nicht nur Ratlosigkeit, Mangel an Orien-
tierungsvermögen u. dgl. zu sehen, wie es der Vf. tut, sondern man darf darin wohl
auch eine Fülle von gegenseitig allerdings noch nicht ausgeglichenen Gesichtspunk-
ten erkennen, wie sie so vielseitig wohl kaum eine andere Geisteswissenschaft auf-
zuweisen hat.
Der die „Aufgaben" enthaltende Hauptteil beginnt mit einem Kapitel über die
Vollendung des großen Inventars. Doch ist merkwürdigerweise davon sehr wenig
die Rede, um so mehr von der Fragwürdigkeit der Stilkritik. Diese wird in ihrer
allerdings oft unertäglichen Überheblichkeit mit begrüßenswerter Robustheit an-
gegriffen; aber so einfach läßt sie sich nun doch wieder nicht erledigen, wie es hier
versucht wird. Die schriftliche Quelle, die Vf. der unsicheren Aussage der Stilkritik
als Rocher de bronze gegenüberstellt, ist nicht ohne weiteres ein solcher. Quellen-
kritik muß es auch in unserer Wissenschaft geben, und ob das Todesdatum eines
Menschen auch das Datum seines Grabmals ist, muß, besonders im Mittelalter, in
jedem einzelnen Falle gefragt, nicht aber in Bausch und Bogen als selbstverständ-
lich angenommen werden.
Es folgt ein Kapitel über „Klärung der Methode", in dem man allerlei findet,
jedoch keine Klärung. In geschickter Weise ist dann der weitere Stoff unter den Ge-
sichtspunkten „Frage nach dem Werden" und „Frage nach dem Sein" zusammen-
gefaßt. Es werden Möglichkeiten angedeutet, „unter Verwertung der alten Epochen-
einteilung und der formalen Kriterien des Festigkeitsgrades der Form, ihres Ver-
schaft. (Kunstwiss. Studien, Bd. 17.) Berlin, Dtsch. Kunstverl., 1935. 64 S.
8°. RM. 1.90.
Diese Schrift will ein Programm sein und beginnt, um dessen Notwendigkeit in
möglichst helles Licht zu setzen, mit einer möglichst düsteren Schilderung der gegen-
wärtigen Lage der Kunstwissenschaft. Einem Jakob Burckhardt wird der nur den
Wissensstoff vermehrende Kunsthistoriker gegenübergestellt, der selbst nicht wertet,
daher auch nicht vom Werte seines Gegenstandes zu überzeugen und erzieherisch
zu wirken vermag. Daß es solche Kunsthistoriker gibt, wird man dem Vf. zugestehen,
aber sie sind auch heute nicht Regel, sondern Ausnahme. Schon Stofferschließung
kann Wertung bedeuten, und sie bedeutet es auf weiten Strecken gerade unserer
Wissenschaft, für die in besonderem Maße das Wort Lionardos gilt, daß die Liebe
zu einer Sache deren Kenntnis nach sich ziehe. Was wußte denn Jakob Burckhardt
von den Wunderwerken der deutschen Barockbaukunst, was von Grünewald, C. D.
Friedrich und der deutschen Plastik des 14. und 15. Jahrhunderts? Daß wir das
alles ins Licht der Forschung gerückt haben, geschah wirklich nicht, um die weißen
Flecken auf dem kunsthistorischen Globus unseres Vaterlandes zu tilgen, sondern
aus neuer Überzeugung von den Werten, die hier verborgen gelegen hatten, und
dem heißen Bemühen, sie wieder zu gewinnen — nicht zum Privatgebrauch für uns
Kunsthistoriker, sondern für uns überhaupt. Man braucht in dem sicher wenig ab-
geklärten Zustande der Kunstwissenschaft nicht nur Ratlosigkeit, Mangel an Orien-
tierungsvermögen u. dgl. zu sehen, wie es der Vf. tut, sondern man darf darin wohl
auch eine Fülle von gegenseitig allerdings noch nicht ausgeglichenen Gesichtspunk-
ten erkennen, wie sie so vielseitig wohl kaum eine andere Geisteswissenschaft auf-
zuweisen hat.
Der die „Aufgaben" enthaltende Hauptteil beginnt mit einem Kapitel über die
Vollendung des großen Inventars. Doch ist merkwürdigerweise davon sehr wenig
die Rede, um so mehr von der Fragwürdigkeit der Stilkritik. Diese wird in ihrer
allerdings oft unertäglichen Überheblichkeit mit begrüßenswerter Robustheit an-
gegriffen; aber so einfach läßt sie sich nun doch wieder nicht erledigen, wie es hier
versucht wird. Die schriftliche Quelle, die Vf. der unsicheren Aussage der Stilkritik
als Rocher de bronze gegenüberstellt, ist nicht ohne weiteres ein solcher. Quellen-
kritik muß es auch in unserer Wissenschaft geben, und ob das Todesdatum eines
Menschen auch das Datum seines Grabmals ist, muß, besonders im Mittelalter, in
jedem einzelnen Falle gefragt, nicht aber in Bausch und Bogen als selbstverständ-
lich angenommen werden.
Es folgt ein Kapitel über „Klärung der Methode", in dem man allerlei findet,
jedoch keine Klärung. In geschickter Weise ist dann der weitere Stoff unter den Ge-
sichtspunkten „Frage nach dem Werden" und „Frage nach dem Sein" zusammen-
gefaßt. Es werden Möglichkeiten angedeutet, „unter Verwertung der alten Epochen-
einteilung und der formalen Kriterien des Festigkeitsgrades der Form, ihres Ver-