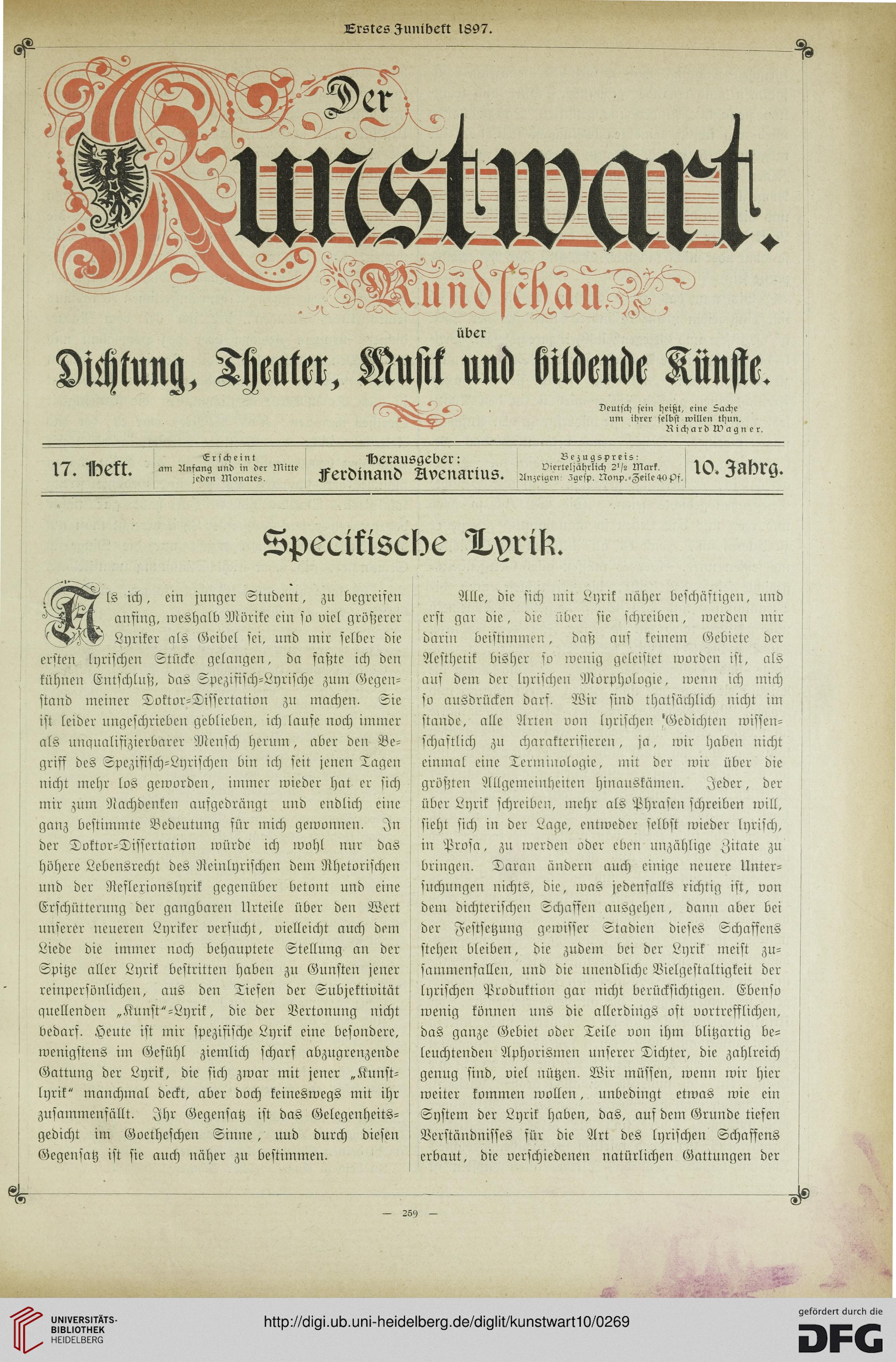Lrstes Amiibekt tS97.
un
u U
c
.- ^
über
DWlMg. Niklilkr, Msik «ni> weniik Mnflk.
17. Ibekt,
Derausgeber:
Ferdinand Nvenarius.
Oierteljährlich 2P2 Mark.
10. Aakrg.
Lpeeikiscbe L^rik.
ls ich, ein junger Student, zu begreisen
ansing, weshalb Mörike ein so oiel größerer
^ Lyriker als Geibel sei, und mir selber die
ersten lyrischen Stücke gelangen, da faßte ich den
kühnen Entschluß, das Spezisisch-Lyrische zum Gegen-
stand meiner Doktor-Dissertation zu machen. Sie
ist leider ungeschrieben geblieben, ich laufe noch immer
als unqualisizierbarer Mensch herum, aber den Be-
griff des Spezifisch-Lyrischen bin ich seit jenen Tagen
nicht mehr los geworden, inimer wieder hat er sich
mir zum Nachdenken ausgedrängt und endlich eine
ganz bestimmte Bedeutung sür mich gewonnen. In
der Doktor-Dissertation würde ich wohl nur das
höhere Lebensrecht des Reinlyrischen dem Rhetorischen
und der Reslexionslyrik gegenüber betont und eine
Erschütterung der gangbaren llrteile über den Wert
unserer neueren Lyriker versucht, vielleicht auch dem
Liede die immer noch behauptete Stellung an der
Spitze aller Lyrik bestritten haben zu Gunsten jener
reinpersönlichen, aus den Tiefen der Subjektivität
guellenden „Kunst"-Lyrik, die der Vertonung nicht
bedars. Heute ist mir spezifische Lyrik eine besondere,
wenigstens im Gefühl ziemlich scharf abzugrenzende
Gattung der Lyrik, die sich zwar mit jener „Kunst-
lyrik" manchmal deckt, aber doch keineswegs mit ihr
zusammensällt. Jhr Gegensatz ist das Gelegenheits-
gedicht im Goetheschen Sinne, uud durch diesen
Gegensatz ist sie auch näher zu bestimmen.
Alle, die sich mit Lyrik näher beschäftigen, und
erst gar die, die über sie schreiben, werden mir
darin beistimmen, daß aus keinem Gebiete der
Aesthelik bisher so wcnig geleistet worden ist, als
aus dem der lyrischen Morphologie, ivenn ich mich
so ausdrücken dars. Wir sind thatsächlich nicht im
stande, alle Arren von lyrischen ^Gedichten wissen-
schaftlich zu charaklerisieren, ja, wir haben nicht
einmal eine Terminologie, mit der wir über die
größten Allgemeinheiten hinauskämen. Jeder, der
über Lyrik schreiben, mehr als Phrasen schreiben will,
sieht sich in der Lage, entweder selbst wieder lyrisch,
in Prosa, zu weröen oder eben unzählige Zitate zu
bringen. Daran ündern auch einige neuere Unter-
suchungen nichts, die, was jedensalls richtig ist, von
dem dichterischen Schaffen ausgehen, dann aber bei
der Festsetzung gewisser Stadien dieses Schaffens
stehen bleiben, die zudem bei der Lyrik meist zu-
sammensallen, und die unendliche Vielgestaltigkeit der
lyrischen Produktion gar nicht berücksichtigen. Ebenso
wenig können uns die allerdings ost vortrefflichen,
das ganze Gebiet oder Teile von ihm blitzartig be-
leuchtenden Aphorismen unserer Dichter, die zahlreich
genug sind, viel nützen. Wir müssen, wenn wir hier
weiter kommen wollen, unbedingt etwas wie ein
System der Lyrik haben, das, aus dem Grunde tiefen
Verständnisses sür die Art des lyrischen Schaffens
erbaut, die verschiedenen natürlichen Gattungen der
un
u U
c
.- ^
über
DWlMg. Niklilkr, Msik «ni> weniik Mnflk.
17. Ibekt,
Derausgeber:
Ferdinand Nvenarius.
Oierteljährlich 2P2 Mark.
10. Aakrg.
Lpeeikiscbe L^rik.
ls ich, ein junger Student, zu begreisen
ansing, weshalb Mörike ein so oiel größerer
^ Lyriker als Geibel sei, und mir selber die
ersten lyrischen Stücke gelangen, da faßte ich den
kühnen Entschluß, das Spezisisch-Lyrische zum Gegen-
stand meiner Doktor-Dissertation zu machen. Sie
ist leider ungeschrieben geblieben, ich laufe noch immer
als unqualisizierbarer Mensch herum, aber den Be-
griff des Spezifisch-Lyrischen bin ich seit jenen Tagen
nicht mehr los geworden, inimer wieder hat er sich
mir zum Nachdenken ausgedrängt und endlich eine
ganz bestimmte Bedeutung sür mich gewonnen. In
der Doktor-Dissertation würde ich wohl nur das
höhere Lebensrecht des Reinlyrischen dem Rhetorischen
und der Reslexionslyrik gegenüber betont und eine
Erschütterung der gangbaren llrteile über den Wert
unserer neueren Lyriker versucht, vielleicht auch dem
Liede die immer noch behauptete Stellung an der
Spitze aller Lyrik bestritten haben zu Gunsten jener
reinpersönlichen, aus den Tiefen der Subjektivität
guellenden „Kunst"-Lyrik, die der Vertonung nicht
bedars. Heute ist mir spezifische Lyrik eine besondere,
wenigstens im Gefühl ziemlich scharf abzugrenzende
Gattung der Lyrik, die sich zwar mit jener „Kunst-
lyrik" manchmal deckt, aber doch keineswegs mit ihr
zusammensällt. Jhr Gegensatz ist das Gelegenheits-
gedicht im Goetheschen Sinne, uud durch diesen
Gegensatz ist sie auch näher zu bestimmen.
Alle, die sich mit Lyrik näher beschäftigen, und
erst gar die, die über sie schreiben, werden mir
darin beistimmen, daß aus keinem Gebiete der
Aesthelik bisher so wcnig geleistet worden ist, als
aus dem der lyrischen Morphologie, ivenn ich mich
so ausdrücken dars. Wir sind thatsächlich nicht im
stande, alle Arren von lyrischen ^Gedichten wissen-
schaftlich zu charaklerisieren, ja, wir haben nicht
einmal eine Terminologie, mit der wir über die
größten Allgemeinheiten hinauskämen. Jeder, der
über Lyrik schreiben, mehr als Phrasen schreiben will,
sieht sich in der Lage, entweder selbst wieder lyrisch,
in Prosa, zu weröen oder eben unzählige Zitate zu
bringen. Daran ündern auch einige neuere Unter-
suchungen nichts, die, was jedensalls richtig ist, von
dem dichterischen Schaffen ausgehen, dann aber bei
der Festsetzung gewisser Stadien dieses Schaffens
stehen bleiben, die zudem bei der Lyrik meist zu-
sammensallen, und die unendliche Vielgestaltigkeit der
lyrischen Produktion gar nicht berücksichtigen. Ebenso
wenig können uns die allerdings ost vortrefflichen,
das ganze Gebiet oder Teile von ihm blitzartig be-
leuchtenden Aphorismen unserer Dichter, die zahlreich
genug sind, viel nützen. Wir müssen, wenn wir hier
weiter kommen wollen, unbedingt etwas wie ein
System der Lyrik haben, das, aus dem Grunde tiefen
Verständnisses sür die Art des lyrischen Schaffens
erbaut, die verschiedenen natürlichen Gattungen der