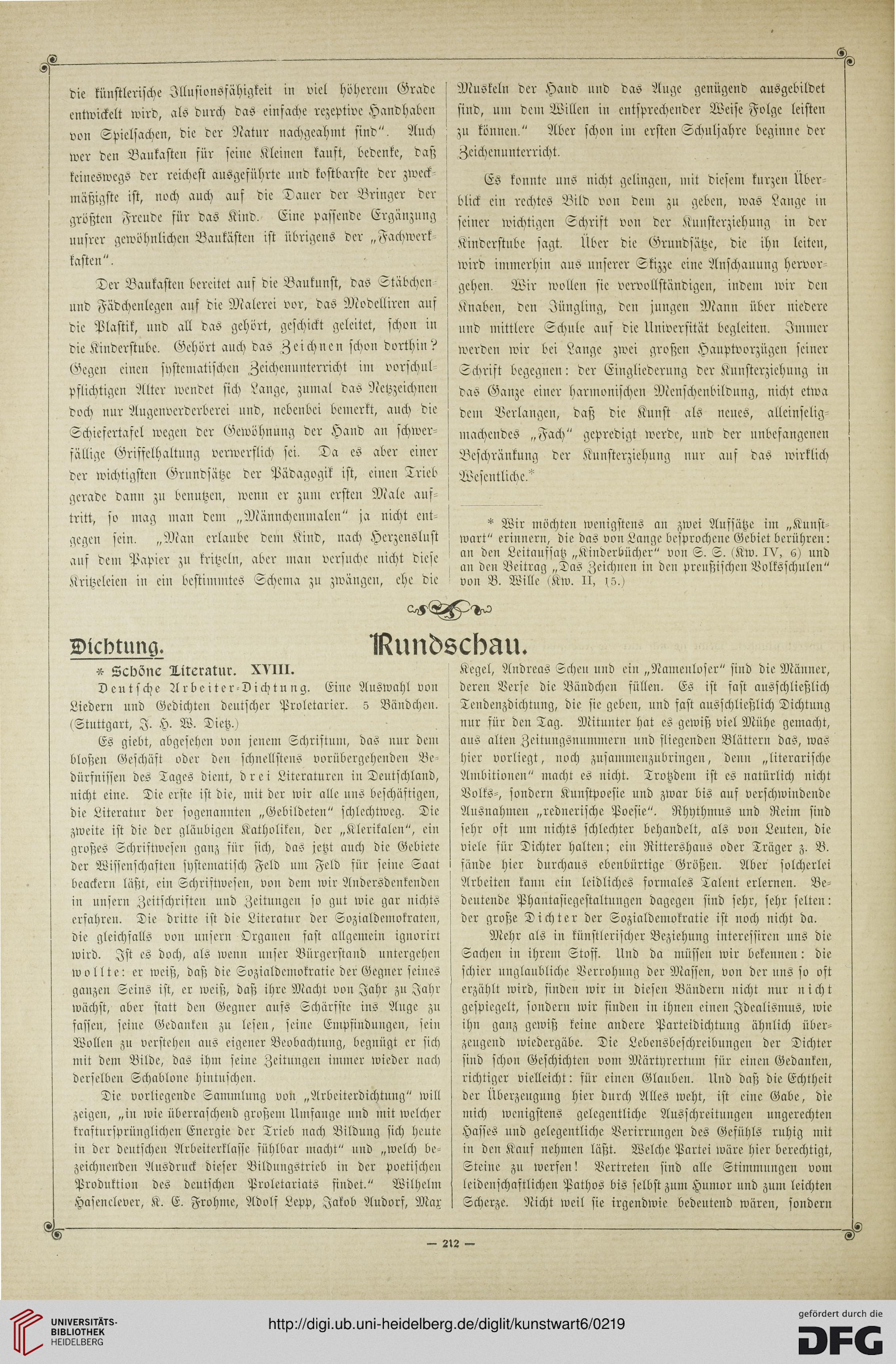die künstlerische Zlluswnsfahigkeit in viel höherem Grade
entwickelt wird, als durch das einfache rezeptive Handhaben
von Spielsachen, die der Natur nachgeahmt sind". Auch
wer den Baukasten für scine Kleinen kanft, bedenke, daß
keineswegs der reichest ausgeführte und kostbarste der zweck
mäßigste ist, noch auch auf die Dauer der Bringer der
größten Freude für das Kind. Eine pasfende Ergänzung
uusrer gewöhnlichen Bankästen ist übrigens der „Fachwerk.
kasten".
Der Baukasten bereitet auf die Baukunsß daö Stäbchen
und Fädchenlegen auf die Malerei vor, das Modelliren anf
die Plastik, nnd all das gehört, geschickt geleitet, fchon in
die Kinderstube. Gehört auch das Zeichnen fchon dorthin?
Gegen einen systematischen Zeichenunterricht im vorschul-
pflichtigen Alter wendet sich Lange, zumal das Netzzeichnen
doch nur Augenverderberei und, nebenbei bemerkt, auch die
Schiefertafel wegen der Gewöhnung der Hand an schwer-
fällige Griffelhaltung verwerflich sei. Da es aber einer
der wichtigsten Grundsätze der Pädagogik ist, einen Trieb
gerade dann zu benutzen, wenn er zum ersten Male auf-
tritt, fo mag man dem „Männchenmalen" ja nicht ent-
gegen fein. „Man erlaube dem Kind, nach Herzenslust
anf dem Papier zn kritzeln, aber man verfuche nicht diese
Kritzeleien in ein bestimmtes Schenia zu zwängen, ehe die
Muskeln der Hand und das Auge genügend ausgebildet
sind, um dem Willen in entsprechender Weife Folge leisten
zu können." Aber schon im ersten Schuljahre beginne der
Zeichenunterricht.
Es konnte uns nicht gelingen, mit diesem kurzen Uber-
blick ein rechtes Bild von dem zu geben, was Lange in
seincr wichtigen Schrift von der Kunsterziehung in dcr
Kinderstube fagt. Über die Grundsätze, die ihn leiten,
wird immerhin auS unserer Skizze eine Anschauung hervor-
gehen. Wir wollen sie vervollständigen, indem wir den
Knaben, den Jüngling, den jungen Mann über niedere
und mittlere Schule auf die ttniversität begleiten. Jmmer
werden wir bei Lange zwei großen Hauptvorzügen feiner
Schrift begegnen: der Eingliederung der Kunsterziehung in
das Ganze einer harmonischen Menschenbildnng, nicht etwa
dem Verlangen, daß die Kunst als neues, alleinfelig-
machendes „Fach" gepredigt werde, und der unbefangenen
Beschränkung der Kunsterziehung nur aus das wirklich
Wefentliche.*
* Wir möchten wenigstens an zwei Aufsätze im „Kunst-
wart" erinnern, die das von Lange befprochene Gebiet berühren:
an den Leitaufsatz „Kinderbücher" von S. S. (Kw. IV, 6) und
an den Beitrag „Das Zeichnen in den preußifchen Volksschulen"
von B. Wille (Kw. II, ^5.)
Nundscbuu.
DLcdtung.
^ Lcvönc Lircratur. XVIII.
Deutsche Arbeiter-Dichtung. Eine Auswahl von
Liedern und Gedichten deutfcher Proletarier. 5 Bändchen. ^
(Stuttgart, I. H. W. Dietz.)
Es giebt, abgesehen von jenem Schriftum, das nur dem
bloßen Geschäft oder den schnellstens vorübergehenden Be-
dürfnissen des Tages dient, drei Literaturen in Deutschland,
nicht eine. Die erste ist die, mit der wir alle uns beschäftigen,
die Literatur der sogenannten „Gebildeten" schlechtweg. Die
zweite ist die der glänbigen Katholiken, der „Klerikalen", ein
großes Schriftwesen ganz für sich, das jetzt auch die Gebiete
der Wissenfchaften systematisch Feld um Feld für feine Saat
beackern läßt, ein Schriftwesen, von dem wir Andersdenkenden
in unsern Zeitfchriften und Zeitungen so gut wie gar nichts
erfahren. Die dritte ist die Literatur der Sozialdemokraten,
die gleichfalls von unsern Organen fast allgemein ignorirt
wird. Jst es doch, als wenn unser Bürgerstand untergehen
wollte: er weiß, daß die Sozialdemokratie der Gegner seines
ganzen Seins ist, er weiß, daß ihre Macht von Jahr zu Jahr
wächst, aber statt den Gegner aufs Schärfste ins Auge zu
fassen, seine Gedanken zu lefen, seine Empfindungen, sein
Wollen zu verstehen ans eigener Beobachtung, begnügt er sich
mit dem Bilde, das ihm seine Zeitnngen immer wieder nach
derselben Schablone hintuschen.
Die vorliegende Sammlung von „Arbeiterdichtung" will
zeigen, „in wie überraschend großem Umfange und mit welcher
kraftiirsprünglichen Energie der Trieb nach Bildung sich heute
in der deutschen Arbeiterklasse fühlbar macht" und „welch be-
zeichnenden Ausdrnck dieser Bildungstrieb in der poetischen
Produktion des deutschen Proletariats findet." Wilhelm
Hasenclever, K. E. Frohme, Adolf Lepp, Jakob Audorf, Max
Kegel, Andreas Scheu und ein „Namenloser" sind die Männer,
deren Verse die Bändchen füllen. Es ist fast ausfchließlich
Tendenzdichtnng, die sie geben, und fast ausfchließlich Dichtung
nur für den Tag. Mitunter hat es gewiß viel Mühe gemacht,
aus alten Zeitnngsnummern und fliegenden Blättern das, was
hier vorliegt, noch zusammenzubringen, denn „literarische
Ambitionen" macht es nicht. Trotzdem ist es natürlich nicht
Volks-, sondern Kunstpoesie und zwar bis auf verschwindende
Ausnahmen „rednerische Poesie". Rhythmns und Reim sind
sehr oft um nichts fchlechter behandelt, als von Leuten, die
viele für Dichter halten; ein Rittershaus oder Träger z. B.
fünde hier durchaus ebenbürtige Größen. Aber solcherlei
Nrbeiten kann ein leidliches formales Talent erlernen. Be-
deutende Phantasiegestaltungen dagegen sind sehr, sehr selten:
der große Dichter der Sozialdemokratie ist noch nicht da.
Mehr als in künstlerischer Beziehung interessiren uns die
Sachen in ihrem Stoff. Und da müssen wir bekennen: die
schier nnglaubliche Verrohung der Maffen, von der nns so oft
erzühlt wird, findcn wir in diesen Bündern nicht nur nicht
gespiegelt, sondern wir finden in ihnen einen Jdealismus, wie
ihn ganz gewiß keine andere Parteidichtung ühnlich über-
zeugend wiedergübe. Die Lebensbeschreibungen der Dichter
sind schon Geschichten vom Märtyrertum für einen Gedanken,
richtiger vielleicht: für einen Glauben. Und daß die Echtheit
der Überzeugung hier durch Alles weht, ist einc Gabe, die
mich wenigstens gelegentliche Ausfchreitungen ungerechten
Hasses und gelegentliche Verirrungen des Gefühls ruhig mit
in den Kauf nehmen läßt. Welche Partei wäre hier berechtigt,
Steine zu werfen! Vertreten sind alle Stimmnngen vom
leidenschaftlichen Pathos bis selbst zum Humor und zum leichten
Scherze. Nicht weil sie irgendwie bedeutend wären, sondern
- 212 —
entwickelt wird, als durch das einfache rezeptive Handhaben
von Spielsachen, die der Natur nachgeahmt sind". Auch
wer den Baukasten für scine Kleinen kanft, bedenke, daß
keineswegs der reichest ausgeführte und kostbarste der zweck
mäßigste ist, noch auch auf die Dauer der Bringer der
größten Freude für das Kind. Eine pasfende Ergänzung
uusrer gewöhnlichen Bankästen ist übrigens der „Fachwerk.
kasten".
Der Baukasten bereitet auf die Baukunsß daö Stäbchen
und Fädchenlegen auf die Malerei vor, das Modelliren anf
die Plastik, nnd all das gehört, geschickt geleitet, fchon in
die Kinderstube. Gehört auch das Zeichnen fchon dorthin?
Gegen einen systematischen Zeichenunterricht im vorschul-
pflichtigen Alter wendet sich Lange, zumal das Netzzeichnen
doch nur Augenverderberei und, nebenbei bemerkt, auch die
Schiefertafel wegen der Gewöhnung der Hand an schwer-
fällige Griffelhaltung verwerflich sei. Da es aber einer
der wichtigsten Grundsätze der Pädagogik ist, einen Trieb
gerade dann zu benutzen, wenn er zum ersten Male auf-
tritt, fo mag man dem „Männchenmalen" ja nicht ent-
gegen fein. „Man erlaube dem Kind, nach Herzenslust
anf dem Papier zn kritzeln, aber man verfuche nicht diese
Kritzeleien in ein bestimmtes Schenia zu zwängen, ehe die
Muskeln der Hand und das Auge genügend ausgebildet
sind, um dem Willen in entsprechender Weife Folge leisten
zu können." Aber schon im ersten Schuljahre beginne der
Zeichenunterricht.
Es konnte uns nicht gelingen, mit diesem kurzen Uber-
blick ein rechtes Bild von dem zu geben, was Lange in
seincr wichtigen Schrift von der Kunsterziehung in dcr
Kinderstube fagt. Über die Grundsätze, die ihn leiten,
wird immerhin auS unserer Skizze eine Anschauung hervor-
gehen. Wir wollen sie vervollständigen, indem wir den
Knaben, den Jüngling, den jungen Mann über niedere
und mittlere Schule auf die ttniversität begleiten. Jmmer
werden wir bei Lange zwei großen Hauptvorzügen feiner
Schrift begegnen: der Eingliederung der Kunsterziehung in
das Ganze einer harmonischen Menschenbildnng, nicht etwa
dem Verlangen, daß die Kunst als neues, alleinfelig-
machendes „Fach" gepredigt werde, und der unbefangenen
Beschränkung der Kunsterziehung nur aus das wirklich
Wefentliche.*
* Wir möchten wenigstens an zwei Aufsätze im „Kunst-
wart" erinnern, die das von Lange befprochene Gebiet berühren:
an den Leitaufsatz „Kinderbücher" von S. S. (Kw. IV, 6) und
an den Beitrag „Das Zeichnen in den preußifchen Volksschulen"
von B. Wille (Kw. II, ^5.)
Nundscbuu.
DLcdtung.
^ Lcvönc Lircratur. XVIII.
Deutsche Arbeiter-Dichtung. Eine Auswahl von
Liedern und Gedichten deutfcher Proletarier. 5 Bändchen. ^
(Stuttgart, I. H. W. Dietz.)
Es giebt, abgesehen von jenem Schriftum, das nur dem
bloßen Geschäft oder den schnellstens vorübergehenden Be-
dürfnissen des Tages dient, drei Literaturen in Deutschland,
nicht eine. Die erste ist die, mit der wir alle uns beschäftigen,
die Literatur der sogenannten „Gebildeten" schlechtweg. Die
zweite ist die der glänbigen Katholiken, der „Klerikalen", ein
großes Schriftwesen ganz für sich, das jetzt auch die Gebiete
der Wissenfchaften systematisch Feld um Feld für feine Saat
beackern läßt, ein Schriftwesen, von dem wir Andersdenkenden
in unsern Zeitfchriften und Zeitungen so gut wie gar nichts
erfahren. Die dritte ist die Literatur der Sozialdemokraten,
die gleichfalls von unsern Organen fast allgemein ignorirt
wird. Jst es doch, als wenn unser Bürgerstand untergehen
wollte: er weiß, daß die Sozialdemokratie der Gegner seines
ganzen Seins ist, er weiß, daß ihre Macht von Jahr zu Jahr
wächst, aber statt den Gegner aufs Schärfste ins Auge zu
fassen, seine Gedanken zu lefen, seine Empfindungen, sein
Wollen zu verstehen ans eigener Beobachtung, begnügt er sich
mit dem Bilde, das ihm seine Zeitnngen immer wieder nach
derselben Schablone hintuschen.
Die vorliegende Sammlung von „Arbeiterdichtung" will
zeigen, „in wie überraschend großem Umfange und mit welcher
kraftiirsprünglichen Energie der Trieb nach Bildung sich heute
in der deutschen Arbeiterklasse fühlbar macht" und „welch be-
zeichnenden Ausdrnck dieser Bildungstrieb in der poetischen
Produktion des deutschen Proletariats findet." Wilhelm
Hasenclever, K. E. Frohme, Adolf Lepp, Jakob Audorf, Max
Kegel, Andreas Scheu und ein „Namenloser" sind die Männer,
deren Verse die Bändchen füllen. Es ist fast ausfchließlich
Tendenzdichtnng, die sie geben, und fast ausfchließlich Dichtung
nur für den Tag. Mitunter hat es gewiß viel Mühe gemacht,
aus alten Zeitnngsnummern und fliegenden Blättern das, was
hier vorliegt, noch zusammenzubringen, denn „literarische
Ambitionen" macht es nicht. Trotzdem ist es natürlich nicht
Volks-, sondern Kunstpoesie und zwar bis auf verschwindende
Ausnahmen „rednerische Poesie". Rhythmns und Reim sind
sehr oft um nichts fchlechter behandelt, als von Leuten, die
viele für Dichter halten; ein Rittershaus oder Träger z. B.
fünde hier durchaus ebenbürtige Größen. Aber solcherlei
Nrbeiten kann ein leidliches formales Talent erlernen. Be-
deutende Phantasiegestaltungen dagegen sind sehr, sehr selten:
der große Dichter der Sozialdemokratie ist noch nicht da.
Mehr als in künstlerischer Beziehung interessiren uns die
Sachen in ihrem Stoff. Und da müssen wir bekennen: die
schier nnglaubliche Verrohung der Maffen, von der nns so oft
erzühlt wird, findcn wir in diesen Bündern nicht nur nicht
gespiegelt, sondern wir finden in ihnen einen Jdealismus, wie
ihn ganz gewiß keine andere Parteidichtung ühnlich über-
zeugend wiedergübe. Die Lebensbeschreibungen der Dichter
sind schon Geschichten vom Märtyrertum für einen Gedanken,
richtiger vielleicht: für einen Glauben. Und daß die Echtheit
der Überzeugung hier durch Alles weht, ist einc Gabe, die
mich wenigstens gelegentliche Ausfchreitungen ungerechten
Hasses und gelegentliche Verirrungen des Gefühls ruhig mit
in den Kauf nehmen läßt. Welche Partei wäre hier berechtigt,
Steine zu werfen! Vertreten sind alle Stimmnngen vom
leidenschaftlichen Pathos bis selbst zum Humor und zum leichten
Scherze. Nicht weil sie irgendwie bedeutend wären, sondern
- 212 —